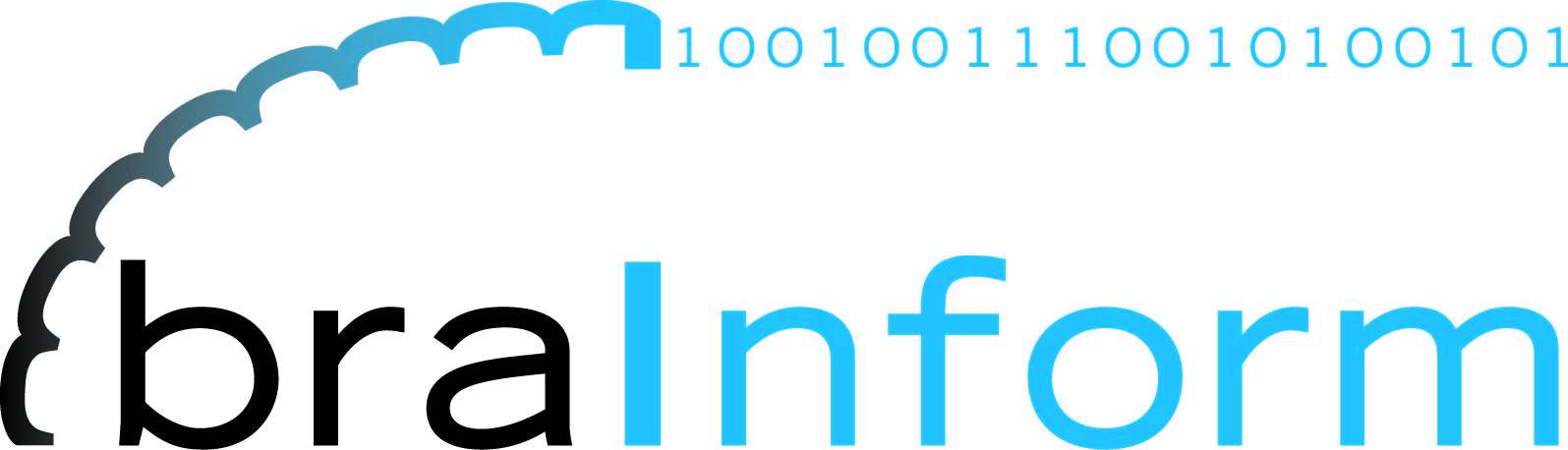China treibt mit Milliardeninvestitionen in Wind, Solar und Batterien die Energiewende voran - auch global
China treibt mit Milliardeninvestitionen in Wind, Solar und Batterien die Energiewende voran - auch global
Zum Fehlanreiz, dass Besitzer kleiner Solaranlagen eine fixe Vergütung erhalten.
Zum Fehlanreiz, dass Besitzer kleiner Solaranlagen eine fixe Vergütung erhalten.
Das aktuelle Stromverteilungsnetz ist nicht gerüstet für die Energiewende.
Das aktuelle Stromverteilungsnetz ist nicht gerüstet für die Energiewende.
Hintergründe zum Stromabkommen Schweiz-EU
Hintergründe zum Stromabkommen Schweiz-EU
Zu den realen Blackout-Risiken als Folge der Energiewende - und wie man damit umgehen könnte.
Zu den realen Blackout-Risiken als Folge der Energiewende - und wie man damit umgehen könnte.
Zu den enormen Kosten der Stabilisierung der Stromnetze aufgrund der stark schwankenden Solarenergie (und unsicheren Wetterprognosen).
Zu den enormen Kosten der Stabilisierung der Stromnetze aufgrund der stark schwankenden Solarenergie (und unsicheren Wetterprognosen).
China wird der weltweite Zulieferer für die Energiewende, Europa wird abgehängt.
China wird der weltweite Zulieferer für die Energiewende, Europa wird abgehängt.
Realismus in der Energiepolitik - statt "Energiewende" wird "Energiekoexistenz" die nächsten Jahrzehnte prägen.
Realismus in der Energiepolitik - statt "Energiewende" wird "Energiekoexistenz" die nächsten Jahrzehnte prägen.
Der Ausbau der Windkraft im Norden Deutschlands führt nicht zu einer entsprechenden Industrialisierung dieses Raums.
Der Ausbau der Windkraft im Norden Deutschlands führt nicht zu einer entsprechenden Industrialisierung dieses Raums.
Eine Auswirkung der deutschen Energiewende: Enorme Schwankungen der Energiepreise.
Eine Auswirkung der deutschen Energiewende: Enorme Schwankungen der Energiepreise.
Übersicht, von wo die Rohstoffe kommen, die es für die Energiewende braucht.
Übersicht, von wo die Rohstoffe kommen, die es für die Energiewende braucht.
Zur Bedeutung der Schweiz als europäischer Stromspeicher.
Zur Bedeutung der Schweiz als europäischer Stromspeicher.
Grossbritannien hat den Ausstieg aus dem Kohlestrom geschafft.
Grossbritannien hat den Ausstieg aus dem Kohlestrom geschafft.
China setzt auf Elektroautos, um vom Öl unabhängger zu werden.
China setzt auf Elektroautos, um vom Öl unabhängger zu werden.
Die Schweiz wiederholt die Fehler von Deutschland: riesige Solarkapazitäten sollen aufggebaut werden, die Unmengen von Abfallstrom im Sommer produzieren, den man bis auf weiteres nicht in den Winter bringt, ausser…
Die Schweiz wiederholt die Fehler von Deutschland: riesige Solarkapazitäten sollen aufggebaut werden, die Unmengen von Abfallstrom im Sommer produzieren, den man bis auf weiteres nicht in den Winter bringt, ausser man investiert Billionen.
Eine Möglichkeit gegen Energieengpässe wäre, Entschädigungen für energieintensive Industrien in Notzeiten vorzusehen (ist aber keine langfristige Strategie)
Eine Möglichkeit gegen Energieengpässe wäre, Entschädigungen für energieintensive Industrien in Notzeiten vorzusehen (ist aber keine langfristige Strategie)
Solare Grosskraftwerke im Magreb sind oft eine neue Form der Ausbeutung der lokalen Bevölkerung, die kaum etwas davon hat.
Solare Grosskraftwerke im Magreb sind oft eine neue Form der Ausbeutung der lokalen Bevölkerung, die kaum etwas davon hat.
Indien setzt verstärkt auf Solarenergie, hat aber noch einen weiten Weg vor sich.
Indien setzt verstärkt auf Solarenergie, hat aber noch einen weiten Weg vor sich.
Wie der Solarexpress in Andalusien Landschaften zerstört.
Wie der Solarexpress in Andalusien Landschaften zerstört.
Die billigste und sicherste Energiewende wird neue Atomkraftwerke brauchen - oder man baut 13 neue Wasserkraftwerke so gross wie Grande Dixence, um das Speicherproblem zu lösen.
Die billigste und sicherste Energiewende wird neue Atomkraftwerke brauchen - oder man baut 13 neue Wasserkraftwerke so gross wie Grande Dixence, um das Speicherproblem zu lösen.
Gemäss neuster Schätzung kostet die Energiewende in Deutschland 1,2 Billionen Euro.
Gemäss neuster Schätzung kostet die Energiewende in Deutschland 1,2 Billionen Euro.
Wie die Energiewende zu einem neuen Pakt zwischen Stadt und Land führen kann.
Wie die Energiewende zu einem neuen Pakt zwischen Stadt und Land führen kann.
Die so genannt positiven Zahlen zur Energiewende in Deutschland sind Ausdruck des Wirtschaftseinbruchs.
Die so genannt positiven Zahlen zur Energiewende in Deutschland sind Ausdruck des Wirtschaftseinbruchs.
Zu den Illusionen der Energiewende - Interview mit einem Energie-Analytiker.
Zu den Illusionen der Energiewende - Interview mit einem Energie-Analytiker.
Die enorm wachsenden Datenmengen führen zu einem enorm steigenden Energiebedarf der Datenzentren
Die enorm wachsenden Datenmengen führen zu einem enorm steigenden Energiebedarf der Datenzentren
Ohne Speicher werden in einer Welt nur mit Solar und Wind die Kosten für Energie extrem hoch sein.
Ohne Speicher werden in einer Welt nur mit Solar und Wind die Kosten für Energie extrem hoch sein.
Die Absurdität der deutschehn Energiewende: Man produziert unmengen Abfall-Strom (wenn er nicht gebraucht wird), der dann veredelt teuer zurückgekauft werden muss.
Die Absurdität der deutschehn Energiewende: Man produziert unmengen Abfall-Strom (wenn er nicht gebraucht wird), der dann veredelt teuer zurückgekauft werden muss.
Solarstrom ist die teuerste Form der Energieversorgung für die Schweiz, wenn man korrekt rechnet.
Solarstrom ist die teuerste Form der Energieversorgung für die Schweiz, wenn man korrekt rechnet.
Warum die Schweiz nach Ansicht der Netzbetreiber ein Stromabkommen mit der EU braucht.
Warum die Schweiz nach Ansicht der Netzbetreiber ein Stromabkommen mit der EU braucht.
Eine Übersicht über die energiepolitischen Herausforderungen für die Schweiz
Eine Übersicht über die energiepolitischen Herausforderungen für die Schweiz
In der solaförderung passiert momentan eine grosse Verschwendung und es werden vorab Fehlanreize subventioniert, welche die zentralen Probleme nicht lösen.
In der solaförderung passiert momentan eine grosse Verschwendung und es werden vorab Fehlanreize subventioniert, welche die zentralen Probleme nicht lösen.
Das aktuelle Fördersystem für Erneuerbare Energien fördert die Produktion von Abfallstrom, der weder gespeichert noch gebraucht werden kann.
Das aktuelle Fördersystem für Erneuerbare Energien fördert die Produktion von Abfallstrom, der weder gespeichert noch gebraucht werden kann.
Zu den offensichtlichen Problemen der künftigen Stromversorgung, während die Befürworter der Decarbonisierung nur Leerformeln von sich geben.
Zu den offensichtlichen Problemen der künftigen Stromversorgung, während die Befürworter der Decarbonisierung nur Leerformeln von sich geben.
Die Schätzungen über die drohenden globalen Klimakosten gehen weit auseinander - doch klar ist, dass auch nichtstun teuer werden wird.
Die Schätzungen über die drohenden globalen Klimakosten gehen weit auseinander - doch klar ist, dass auch nichtstun teuer werden wird.
Der reale Energiemix in der Schweiz ist immer "dreckiger" (Kohlestrom etc.) geworden - die so genannten Zertifikate verschleiern diesen physikalischen Sachverhalt (Ablasshandel pur).
Der reale Energiemix in der Schweiz ist immer "dreckiger" (Kohlestrom etc.) geworden - die so genannten Zertifikate verschleiern diesen physikalischen Sachverhalt (Ablasshandel pur).
Eine erneute Warnung, dass das Schweizer Stromnetz nicht dafür gebaut wurde, die enorme Menge an Überkapazitäts-Sommer-Solarstrom aufzunehmen, wenn man so ausbaut wie man fordert.
Eine erneute Warnung, dass das Schweizer Stromnetz nicht dafür gebaut wurde, die enorme Menge an Überkapazitäts-Sommer-Solarstrom aufzunehmen, wenn man so ausbaut wie man fordert.
Die unangenehmen Warheiten bei der Schweizer Stromproduktion: Strukturelle probleme werden durch die Energiewende verstärkt.
Die unangenehmen Warheiten bei der Schweizer Stromproduktion: Strukturelle probleme werden durch die Energiewende verstärkt.
Eine energiepolitische Einschätzung des russischen Angriffs auf die Ukraine
Eine energiepolitische Einschätzung des russischen Angriffs auf die Ukraine
Das Schweizer Stromnetz ist nicht gemacht für die Energiewende, da besteht noch ein riesiger Investitionsbedarf.
Das Schweizer Stromnetz ist nicht gemacht für die Energiewende, da besteht noch ein riesiger Investitionsbedarf.
Prognosen der globalen Energieversorgung: Erneuerbare lösen (irgendwann) Kohle ab - und was passieren muss, um das 1.5 Grad Ziel zu erreichen.
Prognosen der globalen Energieversorgung: Erneuerbare lösen (irgendwann) Kohle ab - und was passieren muss, um das 1.5 Grad Ziel zu erreichen.
Interview mit einer Energieexpertin, auff die sich der Bund stützt: das Winterstromproblem wird kaum angetöntz, der Widerspruch der enormen Solarinstallation und Überproduktion im Sommer auch nicht. Da wird einiges klar...
Interview mit einer Energieexpertin, auff die sich der Bund stützt: das Winterstromproblem wird kaum angetöntz, der Widerspruch der enormen Solarinstallation und Überproduktion im Sommer auch nicht. Da wird einiges klar...
Der billigste Weg, die Schweiz bis 2050 CO2-neutral zu machen, besteht darin, die bestehenden Kernkraftwerke weiter laufen zu lassen und kontinuierlich zu erneuern.
Der billigste Weg, die Schweiz bis 2050 CO2-neutral zu machen, besteht darin, die bestehenden Kernkraftwerke weiter laufen zu lassen und kontinuierlich zu erneuern.
Der Strommarkt in Europa hat dafür gesorgt, dass niemand mehr Reserven hat. Das sorgt nunu für die absehbare Krise im Winter: geht irgendwo was schief, wird der Strom nicht mehr…
Der Strommarkt in Europa hat dafür gesorgt, dass niemand mehr Reserven hat. Das sorgt nunu für die absehbare Krise im Winter: geht irgendwo was schief, wird der Strom nicht mehr reichen.
Man sollte auf die Energiekrise in Kalifornien vor 20 Jahren schauen, um die heutige Situation zu verstehen.
Man sollte auf die Energiekrise in Kalifornien vor 20 Jahren schauen, um die heutige Situation zu verstehen.
Der Bund erstellt eine Plattform für gegenseitige Hilfe in einer Energiemangellage.
Der Bund erstellt eine Plattform für gegenseitige Hilfe in einer Energiemangellage.
Wie Russland die europäische Energieversorgung sabotieren kann (inkl. Hinweise auf das Pipeline-Netzwerk.
Wie Russland die europäische Energieversorgung sabotieren kann (inkl. Hinweise auf das Pipeline-Netzwerk.
Warum es richtig ist, dass die Strompreise hoch sind - bei den früheren Monopolen wäre es schlimmer (es gäbe gar keinen Strom mehr).
Warum es richtig ist, dass die Strompreise hoch sind - bei den früheren Monopolen wäre es schlimmer (es gäbe gar keinen Strom mehr).
Wie man das Problem der systemkritischen Stromfirmen regulieren sollte.
Wie man das Problem der systemkritischen Stromfirmen regulieren sollte.
Eine Erklärung, wie der Terminmarkt für Strom funkioniert und warum Liquidität wichtig ist.
Eine Erklärung, wie der Terminmarkt für Strom funkioniert und warum Liquidität wichtig ist.
Warum Wasser, Wind und Sonne allein nicht die jeweils benötigte Energie zur richtigen Zeit bereitstellen können
Warum Wasser, Wind und Sonne allein nicht die jeweils benötigte Energie zur richtigen Zeit bereitstellen können
Wie der Strompreis im europäischen Markt entsteht.
Wie der Strompreis im europäischen Markt entsteht.
Es wird langsam klar, dass die Brückentechnologien (vorab Gas) für die langfristigen Ziele der Energiewende die Abhängigkeit von Autokratien erhöht. Und bei den Rohstoffen für die alternativen Energien sieht es…
Es wird langsam klar, dass die Brückentechnologien (vorab Gas) für die langfristigen Ziele der Energiewende die Abhängigkeit von Autokratien erhöht. Und bei den Rohstoffen für die alternativen Energien sieht es auch nicht besser aus.
Am Beispiel von Milch zeigt sich die Abhängigkeit der Lebensmittelversorgung von einer kontinuierlichen Stromversorgung.
Am Beispiel von Milch zeigt sich die Abhängigkeit der Lebensmittelversorgung von einer kontinuierlichen Stromversorgung.
Das grösste Energiesparpotenzial im Haushalt liegt bei den energiefressenden Grossgeräten (mehr als die Hälfte).
Das grösste Energiesparpotenzial im Haushalt liegt bei den energiefressenden Grossgeräten (mehr als die Hälfte).
Das Ziel sollte nicht sein, fossile Energie künstlich ezu verteuern, sondern alternative Energien durch innovationen billiger zu machen (voll gerechnet, denn die Kosten von nicht bedarfsgesteuerter Produktion müssen mit einkalkuliert…
Das Ziel sollte nicht sein, fossile Energie künstlich ezu verteuern, sondern alternative Energien durch innovationen billiger zu machen (voll gerechnet, denn die Kosten von nicht bedarfsgesteuerter Produktion müssen mit einkalkuliert werden).
Wie Japan nach Fukushima in der Lage war, signifikant Strom zu sparen.
Wie Japan nach Fukushima in der Lage war, signifikant Strom zu sparen.
Aufgrund der Zuwanderung werden die Effizienzgewinne in der Schweiz bezüglich Energienutzung kompensiert.
Aufgrund der Zuwanderung werden die Effizienzgewinne in der Schweiz bezüglich Energienutzung kompensiert.
Physikalische Fakten, warum die Schweizer Energiewende Wunschdenken ist.
Physikalische Fakten, warum die Schweizer Energiewende Wunschdenken ist.
Wie Polen still und heimlich auf Solarenergie setzt.
Wie Polen still und heimlich auf Solarenergie setzt.
Eine Anregung, wie das CO2-Gesetz vereinfacht werden sollte.
Eine Anregung, wie das CO2-Gesetz vereinfacht werden sollte.
Warum Atomenergie Teil des Energiemix bleiben muss.
Warum Atomenergie Teil des Energiemix bleiben muss.
Schweizer Energiefirmen investieren im Ausland, weil es hierzulande zu kompliziert ist, Kraftwerke für alternative Energien zu bauen.
Schweizer Energiefirmen investieren im Ausland, weil es hierzulande zu kompliziert ist, Kraftwerke für alternative Energien zu bauen.
Wie Peter Bodenmann die Alpen in ein grosses Solarkraftwerk verwandeln will.
Wie Peter Bodenmann die Alpen in ein grosses Solarkraftwerk verwandeln will.
Auch nach der Energiewende wird man von autokratischen Staaten abhängig sein bei der Energieversorgung - einfach von anderen.
Auch nach der Energiewende wird man von autokratischen Staaten abhängig sein bei der Energieversorgung - einfach von anderen.
Ein düsterer Ausblick auf den nächsten Winter.
Ein düsterer Ausblick auf den nächsten Winter.
Wie Deutschland von Öl und Gas abhängig ist.
Wie Deutschland von Öl und Gas abhängig ist.
Zu den Bedenkenträgern gegen einen Ausbau der Schweizer Energiepotenziale (Wasser, Wind, Solar) in den Bergen.
Zu den Bedenkenträgern gegen einen Ausbau der Schweizer Energiepotenziale (Wasser, Wind, Solar) in den Bergen.
Zu den steigenden und volatilen Strompreise und deren Auswirkungen auf die Energieunternehmen.
Zu den steigenden und volatilen Strompreise und deren Auswirkungen auf die Energieunternehmen.
Der Etikettenschwindel mit den Herkunftszertifikaten im europäischen Strommarkt.
Der Etikettenschwindel mit den Herkunftszertifikaten im europäischen Strommarkt.
Firmen in der Schweiz müssen Szenarien entwerfen, wie sie mit 30% weniger Strom auskommen können.
Firmen in der Schweiz müssen Szenarien entwerfen, wie sie mit 30% weniger Strom auskommen können.
Die Hinweise auf die zunehmende Instabilität der Stromnetze in Europa mehren sich; Frankreich muss nur ein paar AKKs abstellen und die Frequenzschwankungen werden kritisch.
Die Hinweise auf die zunehmende Instabilität der Stromnetze in Europa mehren sich; Frankreich muss nur ein paar AKKs abstellen und die Frequenzschwankungen werden kritisch.
Der europäische Green Deal wird die Europäer mächtig zur Kasse beten.
Der europäische Green Deal wird die Europäer mächtig zur Kasse beten.
Zum Stand der Blockade von Wasserkraft und anderen alternativen Energieträgern in der Schweiz durch Heimat- und Umweltschutz.
Zum Stand der Blockade von Wasserkraft und anderen alternativen Energieträgern in der Schweiz durch Heimat- und Umweltschutz.
Die explodierenden Energiepreise sind eine (notwendige?) Folge der Energiewende.
Die explodierenden Energiepreise sind eine (notwendige?) Folge der Energiewende.
Die strukturellen Gründe für die steigenden Energiepreise.
Die strukturellen Gründe für die steigenden Energiepreise.
Wie Grossbritannien es schaffte, von Kohle als Energieträger für Strom wegzukommen (dank Maggie Thatcher)
Wie Grossbritannien es schaffte, von Kohle als Energieträger für Strom wegzukommen (dank Maggie Thatcher)
Öko-Fördergelder haben im Kanton Zürich kaum eine Lenkungswirkung beim Ersatz fossiler Heizungen
Öko-Fördergelder haben im Kanton Zürich kaum eine Lenkungswirkung beim Ersatz fossiler Heizungen
Wie in Europa aufgrund der Energiewende und anderer Faktoren eine Energiekrise sich aufbaut.
Wie in Europa aufgrund der Energiewende und anderer Faktoren eine Energiekrise sich aufbaut.
Wie in grossbritannien aufgrund einer verfehlten Energiepolitik die Stromkonzerne Konkurs gehen.
Wie in grossbritannien aufgrund einer verfehlten Energiepolitik die Stromkonzerne Konkurs gehen.
Der Ausbau der erneuerbaren Energie in der Schweiz kommt nicht voran.
Der Ausbau der erneuerbaren Energie in der Schweiz kommt nicht voran.
Die Schweiz hat zwar weltweit eine der höchsten CO2-Preise, bepreist aber nur 44% ihrer Emissionen.
Die Schweiz hat zwar weltweit eine der höchsten CO2-Preise, bepreist aber nur 44% ihrer Emissionen.
Die EU will einen Treibhausgas-Zoll.
Die EU will einen Treibhausgas-Zoll.
Zu den Folgen einer Welt ohne Elektrizität. Am 8. Januar 2021 kam es in Europa knapp nicht zu einem Blackout.
Zu den Folgen einer Welt ohne Elektrizität. Am 8. Januar 2021 kam es in Europa knapp nicht zu einem Blackout.
Die Schweiz hat jetzt schon weltweit eine der höchsten Umweltabgaben für CO2 (in realen Zahlen).
Die Schweiz hat jetzt schon weltweit eine der höchsten Umweltabgaben für CO2 (in realen Zahlen).
Warum nicht nur Experten, sondern auch das Volk bei der Klimapolitik mitreden soll - deshalb sollte man über das Referendum zum CO2-Gesetz abstimmen.
Warum nicht nur Experten, sondern auch das Volk bei der Klimapolitik mitreden soll - deshalb sollte man über das Referendum zum CO2-Gesetz abstimmen.
Ein neuer Stromzähler erlaubt es nun, individuell den strombedingten CO2-Abdruck zu berechnen.
Ein neuer Stromzähler erlaubt es nun, individuell den strombedingten CO2-Abdruck zu berechnen.
Warum die jetzige Schweizer Energiepolitik in die Subventionsfalle führt.
Warum die jetzige Schweizer Energiepolitik in die Subventionsfalle führt.
Über den unbegrenzen Stromhunger der Digitalisierung.
Über den unbegrenzen Stromhunger der Digitalisierung.
Bei der Transformation der Energiewirtschaft zeigt die historische Erfahrung (z.B. Holz-Kohle, Kohle-Erdöl), dass die "alten" Energien immer noch einen beträchtlichen Teil der Last tragen.
Bei der Transformation der Energiewirtschaft zeigt die historische Erfahrung (z.B. Holz-Kohle, Kohle-Erdöl), dass die "alten" Energien immer noch einen beträchtlichen Teil der Last tragen.
Zu den Utopien des New Green Deal der EU. Unter anderem wird man in Europa Kernenergie brauchen, will man eine stabile, CO2-freie Stromversorgung.
Zu den Utopien des New Green Deal der EU. Unter anderem wird man in Europa Kernenergie brauchen, will man eine stabile, CO2-freie Stromversorgung.
Warum die Schweiz wohl nicht um Gaskraftwerke herumkommen wird, wenn sie die AKWs abstellen will.
Warum die Schweiz wohl nicht um Gaskraftwerke herumkommen wird, wenn sie die AKWs abstellen will.
Wie in der Schweiz und Deutschland die Abhängigkeit von Importstrom wächst.
Wie in der Schweiz und Deutschland die Abhängigkeit von Importstrom wächst.
Warum man in der Schweiz nachdenken sollte, Gaskraftwerke zu bauen. Es braucht Kapazitäten für den Winter.
Warum man in der Schweiz nachdenken sollte, Gaskraftwerke zu bauen. Es braucht Kapazitäten für den Winter.
Zwei Factsheets zur Wirksamkeit von Instrumenten der Energiepolitik und einer CO2-Lenkungsabgabe für die Minderung des Klimawandels.
Zwei Factsheets zur Wirksamkeit von Instrumenten der Energiepolitik und einer CO2-Lenkungsabgabe für die Minderung des Klimawandels.
Wenn man die Kosten der erneuerbaren Energien korrekt berechnen will, muss man die enormen Zusatzkosten für den Netzausbau mit betrachten.
Wenn man die Kosten der erneuerbaren Energien korrekt berechnen will, muss man die enormen Zusatzkosten für den Netzausbau mit betrachten.
Zum begrenzten Potenzial der Wasserkraft in den Alpen.
Zum begrenzten Potenzial der Wasserkraft in den Alpen.
Das Potenzial der zusätzlichen Wasserkraft ist in der Schweiz deutlich kleiner als vermutet.
Das Potenzial der zusätzlichen Wasserkraft ist in der Schweiz deutlich kleiner als vermutet.
Warum es falsch ist, den "Kühlschrank" als Idealziel des energieeffizienten Wohnens anzusehen.
Warum es falsch ist, den "Kühlschrank" als Idealziel des energieeffizienten Wohnens anzusehen.
Warum sich die Schweiz langfristig überlegen sollte, woher sie im Winter den Strom bekommt.
Warum sich die Schweiz langfristig überlegen sollte, woher sie im Winter den Strom bekommt.
Warum die Schweizer Energielandschaft mittels Smart Metern etc. digitalisiert werden soll (das wird zu Bevormundung führen, deshalb jetzt möglichst autarke Systeme aufbauen).
Warum die Schweizer Energielandschaft mittels Smart Metern etc. digitalisiert werden soll (das wird zu Bevormundung führen, deshalb jetzt möglichst autarke Systeme aufbauen).
Die Schweiz will keine Inland-CO2-Vorgabe machen und setzt auf den "Ablasshandel" (CO2-Reduktion im ausland).
Die Schweiz will keine Inland-CO2-Vorgabe machen und setzt auf den "Ablasshandel" (CO2-Reduktion im ausland).
Wie das CO2-Gesetz bislang wirkte: bei den Brennstoffen ja, bei den Treibstoffen nicht.
Wie das CO2-Gesetz bislang wirkte: bei den Brennstoffen ja, bei den Treibstoffen nicht.
Warum eine Rückkehr ins Atomzeitalter unsinnig ist.
Warum eine Rückkehr ins Atomzeitalter unsinnig ist.
Die Schweiz setzt auf eine Stromimport-Strategie im Winter, was fatal ist.
Die Schweiz setzt auf eine Stromimport-Strategie im Winter, was fatal ist.
Wie man mittels Datenanalyse die Effizienz der Wind- und Solarkraftwerke erhöht.
Wie man mittels Datenanalyse die Effizienz der Wind- und Solarkraftwerke erhöht.
Eine Erinnerung an die technischen Schwierigkeiten der so genannten Energiewende.
Eine Erinnerung an die technischen Schwierigkeiten der so genannten Energiewende.
Stand der Dinge in der Solarenergie-Förderung in der Schweiz.
Stand der Dinge in der Solarenergie-Förderung in der Schweiz.
Die Energiewende in Deutschland erreicht mit sehr viel Geld nur sehr wenig.
Die Energiewende in Deutschland erreicht mit sehr viel Geld nur sehr wenig.
Zu den Problemen der Energieversorgung in der Dritten Welt.
Zu den Problemen der Energieversorgung in der Dritten Welt.
Die Energiewende in Deutschland hat kaum Jobs geschaffen, die subventionsgetriebene Wirtschaft zerstörte sich selbst.
Die Energiewende in Deutschland hat kaum Jobs geschaffen, die subventionsgetriebene Wirtschaft zerstörte sich selbst.
Die Energiewende in Australien führt zu hohen Preisen und Blackouts.
Die Energiewende in Australien führt zu hohen Preisen und Blackouts.
Eine Übersicht, wie in der Schweiz derzeit Strom subventioniert wird.
Eine Übersicht, wie in der Schweiz derzeit Strom subventioniert wird.
Die dunkle Seite der deutschen Energiewende.
Die dunkle Seite der deutschen Energiewende.
Die Energiestrategie 2050 widerspiegelt die Verpolitisierung der Energiebranche, am ende wird ein gigantischer Subventionsapparat stehen, der kaum mehr abgeschafft werden kann.
Die Energiestrategie 2050 widerspiegelt die Verpolitisierung der Energiebranche, am ende wird ein gigantischer Subventionsapparat stehen, der kaum mehr abgeschafft werden kann.
Das Technologieverbot für Nuklearenergie in der Energiewende ist zwar konzeptionell falsch, faktisch aber irrelevant.
Das Technologieverbot für Nuklearenergie in der Energiewende ist zwar konzeptionell falsch, faktisch aber irrelevant.
Zu den Mängeln des deutschen Atomausstiegs und warum ein Schweizer Ausstieg das problem noch verschärfen würde.
Zu den Mängeln des deutschen Atomausstiegs und warum ein Schweizer Ausstieg das problem noch verschärfen würde.
Weitere seltsame Effekte der Energiewende: Deutschland beginnt, den europäischen Energiehandel zu blockieren.
Weitere seltsame Effekte der Energiewende: Deutschland beginnt, den europäischen Energiehandel zu blockieren.
Die Energiewende unterminiert derzeit die Wasserkraft, ohne die es aber keine Energiewende gibt.
Die Energiewende unterminiert derzeit die Wasserkraft, ohne die es aber keine Energiewende gibt.
Die gesundheitlichen Vorteile und Risiken der Energiewende.
Die gesundheitlichen Vorteile und Risiken der Energiewende.
Eine Punkt-für-Punkte-Widerlegung der deutschen Enegiewende-Märchen.
Eine Punkt-für-Punkte-Widerlegung der deutschen Enegiewende-Märchen.
Die Dezentralisierung der Stromversorgung wird grundlegende Änderungen am Stromnetz brauchen.
Die Dezentralisierung der Stromversorgung wird grundlegende Änderungen am Stromnetz brauchen.
Ein aufschlussreiches Interview mit dem Alpiq-Chef, der bald mit dem Konkurs eines europäischen Energieunternehmens rechnet.
Ein aufschlussreiches Interview mit dem Alpiq-Chef, der bald mit dem Konkurs eines europäischen Energieunternehmens rechnet.
Nachdem die Subventionierung der Alternativenergie den Markt verändert hat wollen die deutschen Stromkonzerne auch subventionen - eine Bezahlung der Backup-Kapazitäten konventioneller Kraftwerke.
Nachdem die Subventionierung der Alternativenergie den Markt verändert hat wollen die deutschen Stromkonzerne auch subventionen - eine Bezahlung der Backup-Kapazitäten konventioneller Kraftwerke.
Erneute Darlegung des Unsinns der kostendeckenden Einspeisevergütung.
Erneute Darlegung des Unsinns der kostendeckenden Einspeisevergütung.
Wie der technologische Fortschritt die Chancen der erneuerbaren Energien verbessern.
Wie der technologische Fortschritt die Chancen der erneuerbaren Energien verbessern.
Grafik die zeigt, wie man sich die so genannte Energiewende vorstellt, die zu einem gigantischen Subventionsspiel werden wird.
Grafik die zeigt, wie man sich die so genannte Energiewende vorstellt, die zu einem gigantischen Subventionsspiel werden wird.
Eine Replik zu Borner: Die Zukunft sei internationale stärkere Vernetzung der Stromnetze, nicht Eigenversorgung.
Eine Replik zu Borner: Die Zukunft sei internationale stärkere Vernetzung der Stromnetze, nicht Eigenversorgung.
Silvio Borner über physikalische Grenzen der Energiewende.
Silvio Borner über physikalische Grenzen der Energiewende.
Eine Prognose, wie der Energiemix 2050 aussehen soll.
Eine Prognose, wie der Energiemix 2050 aussehen soll.
Das Beispiel Ghana zeigt die Wichtigkeit eines funktionierenden Stromnetzes und einer ausreichenden Produktion für die Wirtschaft eines Landes.
Das Beispiel Ghana zeigt die Wichtigkeit eines funktionierenden Stromnetzes und einer ausreichenden Produktion für die Wirtschaft eines Landes.
Die deutsche Energiewende führt nun sogar dazu, dass CO2-effiziente Gaskraftwerke abgestellt werden müssen, stattdessen bilden die alten Kohlekraftwerke das Backup für den schwankenden Wind- und Solarstrom.
Die deutsche Energiewende führt nun sogar dazu, dass CO2-effiziente Gaskraftwerke abgestellt werden müssen, stattdessen bilden die alten Kohlekraftwerke das Backup für den schwankenden Wind- und Solarstrom.
China schafft langsam die Verminderung des Kohle-Einsatzes - wegen Alternativenergien und Atomkraft.
China schafft langsam die Verminderung des Kohle-Einsatzes - wegen Alternativenergien und Atomkraft.
Das ist deutsche Energiewende: Subentionen 2014 von 24 Milliarden Euro für Strom, der 2-3 Milliarden Euro wert ist - das ist eine grössenordnung Unterschied. Dafür zahlen die Deutschen fast 50%…
Das ist deutsche Energiewende: Subentionen 2014 von 24 Milliarden Euro für Strom, der 2-3 Milliarden Euro wert ist - das ist eine grössenordnung Unterschied. Dafür zahlen die Deutschen fast 50% mehr für den Strom als der Durchschnitt.
Die deutsche Energiewende kostet Milliarden und bringt der Umwelt nichts.
Die deutsche Energiewende kostet Milliarden und bringt der Umwelt nichts.
Auslegeordnung zur Energiewende-Debatte im Schweizer Parlament.
Auslegeordnung zur Energiewende-Debatte im Schweizer Parlament.
China macht eine Energiewende, um die Abhängigkeit von der Kohle zu verringern und setzt auf einen Mix von Atomenergie und erneuerbare Energie.
China macht eine Energiewende, um die Abhängigkeit von der Kohle zu verringern und setzt auf einen Mix von Atomenergie und erneuerbare Energie.
Ein Thesenpapier zur Vereinbarkeit von Luftreinhaltung und Klimaschutz.
Ein Thesenpapier zur Vereinbarkeit von Luftreinhaltung und Klimaschutz.
Im Bereich Einspeisevergütung wird in der Schweiz derzeit ein gigantischer Subventionsapparat aufgebaut, der noch massive Auswirkungen haben wird.
Im Bereich Einspeisevergütung wird in der Schweiz derzeit ein gigantischer Subventionsapparat aufgebaut, der noch massive Auswirkungen haben wird.
Beispiel Indien, in welchem Zustand ein Strommarkt mit staatlich vorgegebenen Minimalpreisen stagniert: Infrastruktur miserabel, Zugang ans Netz nur durch Bestechung, deshalb Stromdiebe, deshalb kein Einkommen für Stromunternehmen (deshalb miserable Infrastruktur…
Beispiel Indien, in welchem Zustand ein Strommarkt mit staatlich vorgegebenen Minimalpreisen stagniert: Infrastruktur miserabel, Zugang ans Netz nur durch Bestechung, deshalb Stromdiebe, deshalb kein Einkommen für Stromunternehmen (deshalb miserable Infrastruktur & Bestechung).
Wenn es tatsächlich zu enormen CO2-Einsparungen kommen sollte, dann verlieren die Reserven der Energiekonzerne an Wert, was sich auf die Bewertung der Firmen niederschlagen würde (kommt natürlich drauf an, wie…
Wenn es tatsächlich zu enormen CO2-Einsparungen kommen sollte, dann verlieren die Reserven der Energiekonzerne an Wert, was sich auf die Bewertung der Firmen niederschlagen würde (kommt natürlich drauf an, wie hoch die preise für die Energieträger sein werden, die sie noch verkaufen können).
Die neuen "Suffizienz-Überbauungen" wollen so was wie ein quantify self des Energieverbrauchs etablieren. Und wenn das dann geteilt wird und die "Sünder" veröffentlicht werden, wird es interessant...
Die neuen "Suffizienz-Überbauungen" wollen so was wie ein quantify self des Energieverbrauchs etablieren. Und wenn das dann geteilt wird und die "Sünder" veröffentlicht werden, wird es interessant...
Die Energiestrategie der Stadtzürcher Elektrizitätswerke offenbart die Schizophrenie der Energiewende (eine Form von Ablasshandel).
Die Energiestrategie der Stadtzürcher Elektrizitätswerke offenbart die Schizophrenie der Energiewende (eine Form von Ablasshandel).
Zur Abhängigkeit Europas von russischen Energieimporten.
Zur Abhängigkeit Europas von russischen Energieimporten.
Pro und kontra zur Einspesevergütung bzw. Quoten als Fördermassnahme für Ökostrom. Die Frage ist wohl primär, bei welchem System man den Schaden noch eher begrenzen kann.
Pro und kontra zur Einspesevergütung bzw. Quoten als Fördermassnahme für Ökostrom. Die Frage ist wohl primär, bei welchem System man den Schaden noch eher begrenzen kann.
Die chemische Industrie braucht 10% des Gesamtenergiebedarfs der Welt. Hier einige Ideen, wie man diesen Anteil vermindern kann.
Die chemische Industrie braucht 10% des Gesamtenergiebedarfs der Welt. Hier einige Ideen, wie man diesen Anteil vermindern kann.
Ein Bericht zur Zukunft der Stromversorgung Schweiz, insbesondere, wenn die so genannte Energiewende umgesetzt werden soll.
Ein Bericht zur Zukunft der Stromversorgung Schweiz, insbesondere, wenn die so genannte Energiewende umgesetzt werden soll.
Eine erste Einschätzung des geplanten Atomausstiegs in der Schweiz: Verdoppelung des Strom- und Treibstoffpreises. Das Kernproblem von Lenkungsabgaben: Menschen werden immer mehr abhängig von Staatszahlungen. Die zersetzenden Folgen solcher Implementierungen…
Eine erste Einschätzung des geplanten Atomausstiegs in der Schweiz: Verdoppelung des Strom- und Treibstoffpreises. Das Kernproblem von Lenkungsabgaben: Menschen werden immer mehr abhängig von Staatszahlungen. Die zersetzenden Folgen solcher Implementierungen werden kaum bedacht.
Eine Erinnerung der Zahl der Toten, die durch Staudammkatastrophen verursacht worden sind: es sind Zehntausende.
Eine Erinnerung der Zahl der Toten, die durch Staudammkatastrophen verursacht worden sind: es sind Zehntausende.
Eine Einschätzung der mittelfristigen Strompreisentwicklung in Europa. sie werden tendenziell steigen. Gaskraftwerke werden vermehrt gebaut (in der Hoffnung auf die nichtkonventionellen Gasressourcen). Von den CO2-Zielen wird man sich still und…
Eine Einschätzung der mittelfristigen Strompreisentwicklung in Europa. sie werden tendenziell steigen. Gaskraftwerke werden vermehrt gebaut (in der Hoffnung auf die nichtkonventionellen Gasressourcen). Von den CO2-Zielen wird man sich still und heimlich verabschieden.
Bis 2035 wird sich der Verbrauch der fossilen Energiequellen verdoppeln, weil die Einsparungen in den Industrieländern durch die Schwellenländer überkompensiert wird und obwohl das Erdöl teurer werden wird, so die…
Bis 2035 wird sich der Verbrauch der fossilen Energiequellen verdoppeln, weil die Einsparungen in den Industrieländern durch die Schwellenländer überkompensiert wird und obwohl das Erdöl teurer werden wird, so die IEA. Nichtkonventionelles Gas wird zudem die alternativen Energien weiterhin deutlich zu teuer machen.
Eine Beschränkung der CO2-Emmission in der Schweiz ist doppelt unsinnig: Nicht nur ökonomisch dumm (da man viel mehr investieren muss um einen Effekt zu haben), sondern auch ökologisch (weil die…
Eine Beschränkung der CO2-Emmission in der Schweiz ist doppelt unsinnig: Nicht nur ökonomisch dumm (da man viel mehr investieren muss um einen Effekt zu haben), sondern auch ökologisch (weil die Investitionen die Abwanderung von Produktion in Länder mit schlechter CO2-Bilanz noch verstärken, d.h. im Schnitt mehr CO2 produziert wird). Ein weiteres Beispiel, wie Milchbübchen-Moral auf Klimaebene versagt.
Die andere Seite der Windenergie: Landwegnahme in Mexiko.
Die andere Seite der Windenergie: Landwegnahme in Mexiko.
Bulgarien will sich als Standort für Windkraftwerke profilieren.
Bulgarien will sich als Standort für Windkraftwerke profilieren.
Übersicht über die gut 100 Windkraftwerkprojekte, die in der Schweiz geplant sind.
Übersicht über die gut 100 Windkraftwerkprojekte, die in der Schweiz geplant sind.
Die "Stromlücke" betrifft nicht nur die Kraftwerke, sondern auch das Übertragungsnetz, das teilweise auch die von den Kraftwerken erzeugte Energie gar nicht mehr abführen kann (wegen Überbelastung), so dass diese…
Die "Stromlücke" betrifft nicht nur die Kraftwerke, sondern auch das Übertragungsnetz, das teilweise auch die von den Kraftwerken erzeugte Energie gar nicht mehr abführen kann (wegen Überbelastung), so dass diese runtergefahren werden müssen.
2009 hat erstmals China am meisten Energie aller Länder verbraucht (d.h. die USA überholt).
2009 hat erstmals China am meisten Energie aller Länder verbraucht (d.h. die USA überholt).
Was es kosten wird, wenn die EU bis 2020 20% weniger CO2 ausstossen will: deutlich über eine Billion Euro.
Was es kosten wird, wenn die EU bis 2020 20% weniger CO2 ausstossen will: deutlich über eine Billion Euro.
Wie man Innovationen im Energiebereich in den USA fördern könnte.
Wie man Innovationen im Energiebereich in den USA fördern könnte.
Langsam wird der enorme volkswirtschaftliche Schaden der Solarförderung in mehreren Ländern sichtbar: Bald werden allein in Deutschland rund 100 Milliarden Euro (derzeit sind es 52 Milliarden Schulden) aufgewendet, um knapp…
Langsam wird der enorme volkswirtschaftliche Schaden der Solarförderung in mehreren Ländern sichtbar: Bald werden allein in Deutschland rund 100 Milliarden Euro (derzeit sind es 52 Milliarden Schulden) aufgewendet, um knapp ein Prozent des Stroms mit Solar zu decken.
Eine Huldigung der Glühbirne, zu deren Verteidigung offenbar nun Künstler aufrufen.
Eine Huldigung der Glühbirne, zu deren Verteidigung offenbar nun Künstler aufrufen.
Übersicht über den Strommix verschiedener Länder (d.h. welche Primärenergiequellen zum Strom beitragen. Betreffend der Bedeutung der Wasserkraft ist die Schweiz einmalig.
Übersicht über den Strommix verschiedener Länder (d.h. welche Primärenergiequellen zum Strom beitragen. Betreffend der Bedeutung der Wasserkraft ist die Schweiz einmalig.
Übersicht über den Anteil "grüner Projekte" (vorab Alternativenergie) an den Stimulus-Programmen der G-20-Staaten.
Übersicht über den Anteil "grüner Projekte" (vorab Alternativenergie) an den Stimulus-Programmen der G-20-Staaten.
Kritische Beurteilung der derzeit evaluierten Möglichkeiten, CO2 im Boden "endzulagern".
Kritische Beurteilung der derzeit evaluierten Möglichkeiten, CO2 im Boden "endzulagern".
Zu den Debatten, CO2 einzulagern.
Zu den Debatten, CO2 einzulagern.
Die Subventions-Überdosis der Solarstrom-Einspeisung in Deutschland dürfte abgebaut werden - was natürlich die hochsubventionierten Arbeitsplätze im "Solar-Valley" gefährden wird (pro Person 150'000 Euro im Jahr - da könnte man das…
Die Subventions-Überdosis der Solarstrom-Einspeisung in Deutschland dürfte abgebaut werden - was natürlich die hochsubventionierten Arbeitsplätze im "Solar-Valley" gefährden wird (pro Person 150'000 Euro im Jahr - da könnte man das Geld ja direkt verschenken, bringt mehr Leuten etwas).
Wissenschaftler in der Schweiz sind dagegen, die Einspeis-Entschädigung für Ökostrom zu erhöhen - lieber das Geld direkt in die Forschung stecken. Durch die Einspeiserhöhung wird nur alte Öko-Technologie künstlich am…
Wissenschaftler in der Schweiz sind dagegen, die Einspeis-Entschädigung für Ökostrom zu erhöhen - lieber das Geld direkt in die Forschung stecken. Durch die Einspeiserhöhung wird nur alte Öko-Technologie künstlich am Leben erhalten.
Portrait der neuen europäischen Stromnetz-Leitstelle in Laufenburg, deren Bedeutung aber angesichts neuer Netzwerk-Konzepte bald in Frage gestellt werden könnte.
Portrait der neuen europäischen Stromnetz-Leitstelle in Laufenburg, deren Bedeutung aber angesichts neuer Netzwerk-Konzepte bald in Frage gestellt werden könnte.
Warum es unsinnig sei, eine Verteilkonzession für Strom öffentlich auszuschreiben.
Warum es unsinnig sei, eine Verteilkonzession für Strom öffentlich auszuschreiben.
Wie man sich in der Schweiz um gute Plätze für Windkraftanlagen streitet (Folge der Ökostrom-Subventionierung).
Wie man sich in der Schweiz um gute Plätze für Windkraftanlagen streitet (Folge der Ökostrom-Subventionierung).
US-anleger sind mit der Energiepolitik Obamas unzufrieden - die Kurse der Alternativenergie-Firmen sinken.
US-anleger sind mit der Energiepolitik Obamas unzufrieden - die Kurse der Alternativenergie-Firmen sinken.
Ein Positionspapier der chemischen Industrie, wie diese zu einer nachhaltigen Energiezukunft beitragen könne.
Ein Positionspapier der chemischen Industrie, wie diese zu einer nachhaltigen Energiezukunft beitragen könne.
Unter dem Label "CO2-Kompensation" werden die alten Fehler der Entwicklungshilfe neu wiederholt.
Unter dem Label "CO2-Kompensation" werden die alten Fehler der Entwicklungshilfe neu wiederholt.
Vergleich der Nutzung der Windenergie in Dänemark und der Schweiz.
Vergleich der Nutzung der Windenergie in Dänemark und der Schweiz.
Wie Schottland seinen gesamten Elektrizitätsbedarf aus erneuerbaren Quellen produzieren will.
Wie Schottland seinen gesamten Elektrizitätsbedarf aus erneuerbaren Quellen produzieren will.
Wie man in den USA verstärkt an der clean coal Technologie arbeitet (die es zweifellos brauchen wird). Interessant das Energieverbrauchs-Szenario des MIT: Langfristig (bis 2050) muss Energie-Einsparung den grössten Beitrag…
Wie man in den USA verstärkt an der clean coal Technologie arbeitet (die es zweifellos brauchen wird). Interessant das Energieverbrauchs-Szenario des MIT: Langfristig (bis 2050) muss Energie-Einsparung den grössten Beitrag liefern (wobei es an sich seltsam ist, dass diese Komponente in einer Verbrauchs-Grafik erscheint).
Zur Debatte, wie stark man in der Schweiz den Solarstrom fördern soll. Das Beispiel Deutschland zeigt nach neusten Zahlen, wie unwirksam (gemessen an der Erhöhung des Anteils an der gesamten…
Zur Debatte, wie stark man in der Schweiz den Solarstrom fördern soll. Das Beispiel Deutschland zeigt nach neusten Zahlen, wie unwirksam (gemessen an der Erhöhung des Anteils an der gesamten Stromproduktion) eine solche Förderung ist.
Wie man durch geeignete Auswahl der Daten behaupten kann, dass die Schweizer Stromindustrie netto viel CO2 produziere (indem man vom Konsum-Mix statt vom Produktions-Mix ausgeht - die entsprechende Studie wurde…
Wie man durch geeignete Auswahl der Daten behaupten kann, dass die Schweizer Stromindustrie netto viel CO2 produziere (indem man vom Konsum-Mix statt vom Produktions-Mix ausgeht - die entsprechende Studie wurde von der Schweizer Gas- und Ölindustrie gesponsert).
Zwei interessante Grafiken: Endenergieverbrauch 1910-2008 in der Schweiz sowie der Anteil einzelner Sektoren an der gesamten CO2-Emmission (ebenfalls in der Schweiz).
Zwei interessante Grafiken: Endenergieverbrauch 1910-2008 in der Schweiz sowie der Anteil einzelner Sektoren an der gesamten CO2-Emmission (ebenfalls in der Schweiz).
China produziert weitaus am meisten Seltene Erden - Stoffe, die für alternative Energiestrategien bedeutsam sind (z.B. Lanthan und Neodym für Hybridmotoren, Dysprosium für Windkraftwerke) - und behält mehr und mehr…
China produziert weitaus am meisten Seltene Erden - Stoffe, die für alternative Energiestrategien bedeutsam sind (z.B. Lanthan und Neodym für Hybridmotoren, Dysprosium für Windkraftwerke) - und behält mehr und mehr dieser Stoffe im eigenen Land.
Das Problem bei der Förderung erneuerbarer Energien in der Schweiz ist nicht das Geld (es hat deutlich mehr, als faktisch für Projekte beantragt wird), sondern die Bürokratie, die damit verbunden…
Das Problem bei der Förderung erneuerbarer Energien in der Schweiz ist nicht das Geld (es hat deutlich mehr, als faktisch für Projekte beantragt wird), sondern die Bürokratie, die damit verbunden ist, wenn man das Geld erhalten will.
Eine Übersicht über die und Beurteilung der technischen Lösungen zur Abtrennung und Speicherung von CO2 bei Energiegewinnung.
Eine Übersicht über die und Beurteilung der technischen Lösungen zur Abtrennung und Speicherung von CO2 bei Energiegewinnung.
Das Projekt "Wüstenstrom" ist gestartet - derzeit werden aber nur einmal Studien finanziert.
Das Projekt "Wüstenstrom" ist gestartet - derzeit werden aber nur einmal Studien finanziert.
Dritter Artikel zur Energiespar-Debatte, der die Schwachpunkte der Rechsteiner-Replik offenlegt (vorab wenn man den Materialverbrauch pro erzeugte Energieeinheit anschaut).
Dritter Artikel zur Energiespar-Debatte, der die Schwachpunkte der Rechsteiner-Replik offenlegt (vorab wenn man den Materialverbrauch pro erzeugte Energieeinheit anschaut).
Wie die Ukraine ins Geschäft mit Emmissionsrechten einsteigen will (dieser neue künstliche Markt bevorzugt natürlich Länder mit CO2-ineffizienter Energieproduktion - ist das eigentlich ein guter Anreiz?).
Wie die Ukraine ins Geschäft mit Emmissionsrechten einsteigen will (dieser neue künstliche Markt bevorzugt natürlich Länder mit CO2-ineffizienter Energieproduktion - ist das eigentlich ein guter Anreiz?).
Die CO2-Abgabe wird verspätet zurückerstattet, weil man damit Budgets schönen will - da zeigt sich erneut, wie diese Instrumente sehr schnell politisiert und zweckentfremdet werden, je mehr Geldflüsse der Staat…
Die CO2-Abgabe wird verspätet zurückerstattet, weil man damit Budgets schönen will - da zeigt sich erneut, wie diese Instrumente sehr schnell politisiert und zweckentfremdet werden, je mehr Geldflüsse der Staat kontrolliert.
Rechsteiners Replik auf die Kritik am Potential der alternativen Energieträger. Das Bild erscheint mir zu optimistisch (obgleich Optimismus bei der Entwicklung neuer Technologien natürlich wichtig ist).
Rechsteiners Replik auf die Kritik am Potential der alternativen Energieträger. Das Bild erscheint mir zu optimistisch (obgleich Optimismus bei der Entwicklung neuer Technologien natürlich wichtig ist).
Ein ganzes Heft zu den möglichen Szenarien der Schweizer Energiepolitik. Selbst das umfassendste Sparszenario rechnet mit einer "Stromlücke" ab 2018.
Ein ganzes Heft zu den möglichen Szenarien der Schweizer Energiepolitik. Selbst das umfassendste Sparszenario rechnet mit einer "Stromlücke" ab 2018.
Eine Beurteilung der Nachfolgetechnologien der Glühbirne aus energiepolitischer Sicht.
Eine Beurteilung der Nachfolgetechnologien der Glühbirne aus energiepolitischer Sicht.
Warum die Investitionen in alternative Energiesysteme weder der Wirtschaft noch der Umwelt nützen würden.
Warum die Investitionen in alternative Energiesysteme weder der Wirtschaft noch der Umwelt nützen würden.
Eine Debatte, wie der Emissionshandel in der Schweiz aussehen soll.
Eine Debatte, wie der Emissionshandel in der Schweiz aussehen soll.
Eine Reportage über die nationale Übertragungs-leitstelle: Überwachung der Stromnetze in der Schweiz.
Eine Reportage über die nationale Übertragungs-leitstelle: Überwachung der Stromnetze in der Schweiz.
Ein Essay zur Frage, wie man in einer Gesellschaft, die immer mehr von elektronischen Netzen/Systemen abhängig ist, Energie sparen kann.
Ein Essay zur Frage, wie man in einer Gesellschaft, die immer mehr von elektronischen Netzen/Systemen abhängig ist, Energie sparen kann.
Ein Projekt des deutschen Lampenherstellers Osram, das lokale Stromerzeugung (Solar etc.) in Afrika zwecks Lichtproduktion fördert.
Ein Projekt des deutschen Lampenherstellers Osram, das lokale Stromerzeugung (Solar etc.) in Afrika zwecks Lichtproduktion fördert.
Grundsätzliche Kritik an Klimazertifikaten: der staat verkauft hier etwas, das ihm gar nicht gehört (sondern allen - doch das würde verlangen, dass die Menschheit so was wie ein Völkerrechtssubjekt wird).
Grundsätzliche Kritik an Klimazertifikaten: der staat verkauft hier etwas, das ihm gar nicht gehört (sondern allen - doch das würde verlangen, dass die Menschheit so was wie ein Völkerrechtssubjekt wird).
Eine Verabschiedung der Glühbirnen der Klassen F und G.
Eine Verabschiedung der Glühbirnen der Klassen F und G.
Zu den Problemen und der Uneinigkeit in der Regulierung des Emmissionshandels in der EU.
Zu den Problemen und der Uneinigkeit in der Regulierung des Emmissionshandels in der EU.
Die derzeitige EU-Klimapolitik nützt dem Klima gar nichts: Die meisten Förderungsmassnahmen sind iineffizient (wenn man richtig rechnet), Emmissionszertifikate nur in europa vermindern die Emmissionen nicht.
Die derzeitige EU-Klimapolitik nützt dem Klima gar nichts: Die meisten Förderungsmassnahmen sind iineffizient (wenn man richtig rechnet), Emmissionszertifikate nur in europa vermindern die Emmissionen nicht.
Abschätzung des Anteils nachwachsender Rohstoffe am Weltenergiebedarf bis 2050: Nicht mehr als 10%.
Abschätzung des Anteils nachwachsender Rohstoffe am Weltenergiebedarf bis 2050: Nicht mehr als 10%.
Überblick über die europäische Energiepolitik und deren Abhängigkeit von russischen Gasimporten (inkl. Karte!).
Überblick über die europäische Energiepolitik und deren Abhängigkeit von russischen Gasimporten (inkl. Karte!).
In Abu Dhabi soll eine Öko-Musterstadt entstehen, die nur erneuerbare Energie nutzen will und keine Schadstoffe an die Umwelt abgeben soll (Masdar City).
In Abu Dhabi soll eine Öko-Musterstadt entstehen, die nur erneuerbare Energie nutzen will und keine Schadstoffe an die Umwelt abgeben soll (Masdar City).
Litauens Stromversorgung ist massgeblich von einem Kernkraftwerk abhängig, das nuun aufgrund einer EU-Vereinbarung abgestellt werden muss. Das land ist dann weitgehend von Russland abhängig.
Litauens Stromversorgung ist massgeblich von einem Kernkraftwerk abhängig, das nuun aufgrund einer EU-Vereinbarung abgestellt werden muss. Das land ist dann weitgehend von Russland abhängig.
Wie der Strommarkt liberalisiert werden soll. Die jetzige Situation ist eine unselige Mischrechnung.
Wie der Strommarkt liberalisiert werden soll. Die jetzige Situation ist eine unselige Mischrechnung.
Die polnische Energieversorgung hängt stark von Kohle ab, was mit den CO2-Zielen der EU kollidiert.
Die polnische Energieversorgung hängt stark von Kohle ab, was mit den CO2-Zielen der EU kollidiert.
Beispiel der Folgen einer verfehlten Energiepolitik: Kirgistan erwartet einen harten Winter.
Beispiel der Folgen einer verfehlten Energiepolitik: Kirgistan erwartet einen harten Winter.
Kiener argumentiert für zwei neue Schweizer Atomkraftwerke, wobei sich die Betreiber hier aber auf zwei Projekte einigen müssen.
Kiener argumentiert für zwei neue Schweizer Atomkraftwerke, wobei sich die Betreiber hier aber auf zwei Projekte einigen müssen.
Zu den aktuellen Problemen des Emissionshandels.
Zu den aktuellen Problemen des Emissionshandels.
Der Wettbewerb zwischen demokratischen und autoritären Systemen hat eine wichtige energiepolitische Komponente: letztere sichern sich die Ressourcen schneller und gewalttätiger. Energiesparen reicht nicht, der Westen muss reagieren. Ein zweiter Artikel…
Der Wettbewerb zwischen demokratischen und autoritären Systemen hat eine wichtige energiepolitische Komponente: letztere sichern sich die Ressourcen schneller und gewalttätiger. Energiesparen reicht nicht, der Westen muss reagieren. Ein zweiter Artikel über die Energiepreise in China, wo keine Marktmechanismen herrschen und deshalb (?) Energie verschwendet wird.
Zum Energieverbrauch der ICT-Infrastruktur und wie diese aber auch für das Energiesparen eingesetzt werden kann.
Zum Energieverbrauch der ICT-Infrastruktur und wie diese aber auch für das Energiesparen eingesetzt werden kann.
Nun hat auch die OECD festgestellt, dass sich die Subventionen auf Biotreibstoffe (der ersten Generation) nicht auszahlen (nicht nur hinsichtlich Klima).
Nun hat auch die OECD festgestellt, dass sich die Subventionen auf Biotreibstoffe (der ersten Generation) nicht auszahlen (nicht nur hinsichtlich Klima).
Die Ansichten von Held hinsichtlich der energiepolitischen Blockaden im Bereich Atomenergie in der Schweiz.
Die Ansichten von Held hinsichtlich der energiepolitischen Blockaden im Bereich Atomenergie in der Schweiz.
In der EU sollen Glühbirnen ab 2009 schrittweise verboten werden.
In der EU sollen Glühbirnen ab 2009 schrittweise verboten werden.
Die Internationale Energieagentur will eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch. Eine Halbierung der Co2-emmissionen bis 2050 braucht 45 Billionen Dollar (also über eine Billion pro Jahr).
Die Internationale Energieagentur will eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch. Eine Halbierung der Co2-emmissionen bis 2050 braucht 45 Billionen Dollar (also über eine Billion pro Jahr).
Zu den Widersprüchen in der Energie- und Klimapolitik der EU. Jedes Land hat andere Prioritäten (wie es auch sein sollte).
Zu den Widersprüchen in der Energie- und Klimapolitik der EU. Jedes Land hat andere Prioritäten (wie es auch sein sollte).
Diskussion zur Frage, inwieweit die 2000-Watt-Gesellschaft ein realistisches Ziel sei.
Diskussion zur Frage, inwieweit die 2000-Watt-Gesellschaft ein realistisches Ziel sei.
Die IPCC unterschätzt die technologische Herausforderung, welche eine Verringerung des CO2-Ausstosses mit sich bringt.
Die IPCC unterschätzt die technologische Herausforderung, welche eine Verringerung des CO2-Ausstosses mit sich bringt.
Zu den Kosten von Umweltschutzmassnahmen im Energiebereich gemäss OECD: Wachstumseinbussen sind deutlich geringer, als wenn man nichts macht.
Zu den Kosten von Umweltschutzmassnahmen im Energiebereich gemäss OECD: Wachstumseinbussen sind deutlich geringer, als wenn man nichts macht.
Eine Geschichte des Minergie-Programms in der Schweiz (30 Jahre alt).
Eine Geschichte des Minergie-Programms in der Schweiz (30 Jahre alt).
Zu den politischen Massnahmen, mit denen man die Emissionen der Luftfahrt reduzieren könnte (dazu auch Zahlen).
Zu den politischen Massnahmen, mit denen man die Emissionen der Luftfahrt reduzieren könnte (dazu auch Zahlen).
Bericht über das Emissionshandelsregister in der Schweiz
Bericht über das Emissionshandelsregister in der Schweiz
Der Bundesrat verzichtet momentan auf eine CO2-Abgabe (und richtet sich an der EU aus): Übersicht über die wichtigsten politischen Ziele.
Der Bundesrat verzichtet momentan auf eine CO2-Abgabe (und richtet sich an der EU aus): Übersicht über die wichtigsten politischen Ziele.
Zur Diskussion u die "grauen" CO2-Emissionen.
Zur Diskussion u die "grauen" CO2-Emissionen.
Ein Problem bei der Berechnung von CO2-Emmissionen: die "grauen CO2-Emmissionen" (früher nannte man das noch die graue Energie - also die in den Materialien versteckte Energie, die für deren Herstellung…
Ein Problem bei der Berechnung von CO2-Emmissionen: die "grauen CO2-Emmissionen" (früher nannte man das noch die graue Energie - also die in den Materialien versteckte Energie, die für deren Herstellung und Verfeinerung notwendig sind).
Die Pharmaindustrie bereitet sich (hinsichtlich Energie) auf die Ablösung vom Erdöl vor - macht ja Sinn angesichts der energieintensiven Prozesse in der Chemie.
Die Pharmaindustrie bereitet sich (hinsichtlich Energie) auf die Ablösung vom Erdöl vor - macht ja Sinn angesichts der energieintensiven Prozesse in der Chemie.
Die Energiepolitik Chinas: ausbau von Kernkraft und erneuerbaren Energien.
Die Energiepolitik Chinas: ausbau von Kernkraft und erneuerbaren Energien.
Übersicht über den Alternativenergie-Boom in den Golfstaaten.
Übersicht über den Alternativenergie-Boom in den Golfstaaten.
Wie China verstärkt als Investor und Anbieter von nachhaltiger Energie auftreten wird.
Wie China verstärkt als Investor und Anbieter von nachhaltiger Energie auftreten wird.
Wie die EU-Kommission den Emissionshandel gestalten will (dazu eine Grafik des Anteils erneuerbarer Energien an der Energieproduktion europäischer Staaten).
Wie die EU-Kommission den Emissionshandel gestalten will (dazu eine Grafik des Anteils erneuerbarer Energien an der Energieproduktion europäischer Staaten).
Studie über den sich verschärfenden Konkurrenzkampf der Energieversorger: Merger-Potential von 50% (Netzbetreiber) und 25% (Produzenten).
Studie über den sich verschärfenden Konkurrenzkampf der Energieversorger: Merger-Potential von 50% (Netzbetreiber) und 25% (Produzenten).
Der Standpunkt von Economiesuisse zur Schweizer Energiepolitik: man setze zu wenig auf Wettbewerb.
Der Standpunkt von Economiesuisse zur Schweizer Energiepolitik: man setze zu wenig auf Wettbewerb.
Wie die Lobbyisten auf die neuen Klimaziele der EU-Kommission reagieren.
Wie die Lobbyisten auf die neuen Klimaziele der EU-Kommission reagieren.
Wie sich die Schweiz angesichts der steigenden Strompreise und Energie-Engpässe in Europa positionieren soll.
Wie sich die Schweiz angesichts der steigenden Strompreise und Energie-Engpässe in Europa positionieren soll.
Economiesuisse meint: die Schweiz solle ihre CO2-Emissionsziele nicht mit einer CO2-Abgabe, sondern mit Emissionshandel erreichen. Zudem eine Grafik mit den CO2-Emissionen pro einheit BIP (da ist die Schweiz europaweit führend).
Economiesuisse meint: die Schweiz solle ihre CO2-Emissionsziele nicht mit einer CO2-Abgabe, sondern mit Emissionshandel erreichen. Zudem eine Grafik mit den CO2-Emissionen pro einheit BIP (da ist die Schweiz europaweit führend).
Ein künftiges Grossprojekt: Sonnenenergie im Magreb gewinnen und nach Europa exportieren (energy super grid).
Ein künftiges Grossprojekt: Sonnenenergie im Magreb gewinnen und nach Europa exportieren (energy super grid).
Prognose des Weltenergierates: Energie-Angebot würde sich bis 2050 verdoppeln.
Prognose des Weltenergierates: Energie-Angebot würde sich bis 2050 verdoppeln.
Überblick über die Ersatztechnologien für die Glühbirne.
Überblick über die Ersatztechnologien für die Glühbirne.
Italien ist in hohem Masse abhängig von Erdgas (d.h. das Interesse an Kernkraft steigt wieder).
Italien ist in hohem Masse abhängig von Erdgas (d.h. das Interesse an Kernkraft steigt wieder).
Prognose der Entwicklung des Energieverbrauchs in Europa bis 2020: Investitionsbedarf von 400 bis 500 Milliarden Euro.
Prognose der Entwicklung des Energieverbrauchs in Europa bis 2020: Investitionsbedarf von 400 bis 500 Milliarden Euro.
Das energiepolitische Problem sei nicht der Klimawandel, sondern die zu erwartenden Verteilkämpfe um die letzten fossilen Energiereserven.
Das energiepolitische Problem sei nicht der Klimawandel, sondern die zu erwartenden Verteilkämpfe um die letzten fossilen Energiereserven.
Wie sich der Emissionshandel auf die Entwicklungsländer auswirken kann. Problem ist insbesondere: wie berechnet man die CO2-Einsparung?
Wie sich der Emissionshandel auf die Entwicklungsländer auswirken kann. Problem ist insbesondere: wie berechnet man die CO2-Einsparung?
Der WWF listet sieben "Mythen" der Schweizer Klimadiskussion (d.h. Energiepolitik) auf: vorab Kritik am Emissionshandel.
Der WWF listet sieben "Mythen" der Schweizer Klimadiskussion (d.h. Energiepolitik) auf: vorab Kritik am Emissionshandel.
Ein Plädoyer, die Stromnetze in Europa von den Energiekonzernen zu trennen (das jedenfalls meint die EU-Kommission).
Ein Plädoyer, die Stromnetze in Europa von den Energiekonzernen zu trennen (das jedenfalls meint die EU-Kommission).
die Chemieindustrie braucht viel Energie - und ist entsprechend skeptisch, wenn es um Klimaschutz geht, der via Verteuerung von Energie funktionieren soll.
die Chemieindustrie braucht viel Energie - und ist entsprechend skeptisch, wenn es um Klimaschutz geht, der via Verteuerung von Energie funktionieren soll.
Gaskraftwerke können die Kernkraftwerk in der Schweiz nicht ersetzen, sollten diese dereinst vom Netz gehen.
Gaskraftwerke können die Kernkraftwerk in der Schweiz nicht ersetzen, sollten diese dereinst vom Netz gehen.
Kiener vergleicht Kernrkaft und Gas hinsichtlich Versorgungssicherheit für die Schweiz: Kernkraft ist besser.
Kiener vergleicht Kernrkaft und Gas hinsichtlich Versorgungssicherheit für die Schweiz: Kernkraft ist besser.
Abschätzung der Wohlstandsverluste in der Schweiz als Folge der Klimaerwärmung. Zudem die Debatte um eine Treibstoff-Abgabe.
Abschätzung der Wohlstandsverluste in der Schweiz als Folge der Klimaerwärmung. Zudem die Debatte um eine Treibstoff-Abgabe.
Wie die deutsche Industrie von der Klimapolitik der Regierung profitiert habe (vorab Solar und Wind).
Wie die deutsche Industrie von der Klimapolitik der Regierung profitiert habe (vorab Solar und Wind).
Plädoyer, dass sich in Nachhaltigkeitsindikatoren auch die CO2-Intensität verschiedener Energieanwendungen widerspiegeln soll.
Plädoyer, dass sich in Nachhaltigkeitsindikatoren auch die CO2-Intensität verschiedener Energieanwendungen widerspiegeln soll.
Zu den Umstellungsproblemen, wenn statt konventionelle Glühbirnen LED-Dioden und dergleichen verwendet werden sollten.
Zu den Umstellungsproblemen, wenn statt konventionelle Glühbirnen LED-Dioden und dergleichen verwendet werden sollten.
Übersicht, welche CO2-Reduktionsmassnahmen mit welchen Kosten verbunden sind (weitaus am besten ist immer noch: Häuser isolieren).
Übersicht, welche CO2-Reduktionsmassnahmen mit welchen Kosten verbunden sind (weitaus am besten ist immer noch: Häuser isolieren).
Energy Globe stellt eine Methode zur CO2-Bilanzierung vor.
Energy Globe stellt eine Methode zur CO2-Bilanzierung vor.
Szenarien des PSI zum künftigen Energieverbrauch der Schweiz (2000 Watt erscheint weiterhin utopisch).
Szenarien des PSI zum künftigen Energieverbrauch der Schweiz (2000 Watt erscheint weiterhin utopisch).
Beispiel einer neuen LED-Anwendung von Seoul Semiconductor.
Beispiel einer neuen LED-Anwendung von Seoul Semiconductor.
Einige kritische Gedanken zum Emmissionshandel.
Einige kritische Gedanken zum Emmissionshandel.
Warum CO2-grenzwerte bei Autos falsch sein sollen.
Warum CO2-grenzwerte bei Autos falsch sein sollen.
Zu den Problemen der Liberalisierung der Stromnetze.
Zu den Problemen der Liberalisierung der Stromnetze.
Eine Übersicht über die Ausgaben der öffentlichen Hand in verschiedene Bereiche der Energieforschung.
Eine Übersicht über die Ausgaben der öffentlichen Hand in verschiedene Bereiche der Energieforschung.
Zur Geschichte der Sommerzeit, die einst aus Energiespargründen in Kriegszeiten eingeführt wurde - einen Effekt, den man aber nie wirtklich beweisen konnte.
Zur Geschichte der Sommerzeit, die einst aus Energiespargründen in Kriegszeiten eingeführt wurde - einen Effekt, den man aber nie wirtklich beweisen konnte.
Zu den Schwachstellen im Schweizer Stromnetz und wie diese angegangen werden sollten.
Zu den Schwachstellen im Schweizer Stromnetz und wie diese angegangen werden sollten.
Hinweis darauf, dass auch die so genannten Alternativenergien nicht ohne Umweltschädigung zu haben sind.
Hinweis darauf, dass auch die so genannten Alternativenergien nicht ohne Umweltschädigung zu haben sind.
Beispiel einer neue Hochleistungs-LED-Lampe (zur Diskussion um die Ablösung der Glühbirne).
Beispiel einer neue Hochleistungs-LED-Lampe (zur Diskussion um die Ablösung der Glühbirne).
Wie man mittels OLED neue Beleuchtungen machen kann.
Wie man mittels OLED neue Beleuchtungen machen kann.
Warum China und Indien in einer globalen Energiepolitik immer wichtiger werden.
Warum China und Indien in einer globalen Energiepolitik immer wichtiger werden.
Argumente gegen eine zu starke Ausrichtung auf die Kernenergie in der herrschenden Debatte um Energiepolitik in der Schweiz.
Argumente gegen eine zu starke Ausrichtung auf die Kernenergie in der herrschenden Debatte um Energiepolitik in der Schweiz.
Zur Energiepolitik des Bundesrates: Gas- und Kernkraftwerke werden ebenfalls angestrebt, nicht nur erneuerbare Energien.
Zur Energiepolitik des Bundesrates: Gas- und Kernkraftwerke werden ebenfalls angestrebt, nicht nur erneuerbare Energien.
Zur Forschung über organische Leuchtdioden (das EU-Projekt OLLA): Zahlen zur erwarteten Energieeinsparung.
Zur Forschung über organische Leuchtdioden (das EU-Projekt OLLA): Zahlen zur erwarteten Energieeinsparung.
Zwei Artikel zum Thema Energie-Effizienz, und ein dritter Arkikel bringt eine Einschätzung des CO2-Marktes.
Zwei Artikel zum Thema Energie-Effizienz, und ein dritter Arkikel bringt eine Einschätzung des CO2-Marktes.
Wie neue Energien zu einem interessanten Anlagethema geworden sind.
Wie neue Energien zu einem interessanten Anlagethema geworden sind.
Wie man in Australien den Emissionshandel implementieren könnte.
Wie man in Australien den Emissionshandel implementieren könnte.
Ein Plädoyer dafür, dass man durch konsequente Energieeffizienz keine Grosskraftwerke mehr bauen müsse (halte ich für unplausibel).
Ein Plädoyer dafür, dass man durch konsequente Energieeffizienz keine Grosskraftwerke mehr bauen müsse (halte ich für unplausibel).
In den Golfstaaten plant man, langfristig in grossem Massstab Wasserstoff zu produzieren.
In den Golfstaaten plant man, langfristig in grossem Massstab Wasserstoff zu produzieren.
Zum Konflikt Stromversorgung und Klimaschutz hinsichtlich des Baus von Gaskraftwerken.
Zum Konflikt Stromversorgung und Klimaschutz hinsichtlich des Baus von Gaskraftwerken.
Die SATW schätzt in einer Studie das Potential der erneuerbaren Energien in der Schweiz (inklusive Wasserkraft) ab. Der Zeithorizont reicht bis 2070, was natürlich lange ist hinsichtlich der Frage, welchen…
Die SATW schätzt in einer Studie das Potential der erneuerbaren Energien in der Schweiz (inklusive Wasserkraft) ab. Der Zeithorizont reicht bis 2070, was natürlich lange ist hinsichtlich der Frage, welchen Anteil die erneuerbaren Energien haben werden. Ein Drittel scheint realistisch.
Warum sich die Stromsparmassnahmen in der Schweiz kaum ausgewirkt haben.
Warum sich die Stromsparmassnahmen in der Schweiz kaum ausgewirkt haben.
Die EU will eine Energiepolitik vorantreiben, welche mehr Rücksicht auf den Klimawandel nimmt.
Die EU will eine Energiepolitik vorantreiben, welche mehr Rücksicht auf den Klimawandel nimmt.
Porträt des Schweizerischen Energierates, einem Gremium für die Einbindung der Schweiz in die internationale Energiepolitik.
Porträt des Schweizerischen Energierates, einem Gremium für die Einbindung der Schweiz in die internationale Energiepolitik.
Kritische Beurteilung des Emissionshandels.
Kritische Beurteilung des Emissionshandels.
Konkretisierung von Leuenbergers Vorschlag einer weltweiten CO2-Abgabe in Form eines Klimarappens.
Konkretisierung von Leuenbergers Vorschlag einer weltweiten CO2-Abgabe in Form eines Klimarappens.
Zu den Ursachen des Blackouts vom November: es gibt Grundprobleme wie die fehlende Anpassung der Netze an die zunehmende Windenergie, welche die Netze auf bisher schlecht vorhersehbare Weise beeinflussen.
Zu den Ursachen des Blackouts vom November: es gibt Grundprobleme wie die fehlende Anpassung der Netze an die zunehmende Windenergie, welche die Netze auf bisher schlecht vorhersehbare Weise beeinflussen.
Die deutsche Regierung will den Emissionshandel derart ausgestalten, dass neue Kraftwerke gebaut werden – und zwar fossil betriebene.
Die deutsche Regierung will den Emissionshandel derart ausgestalten, dass neue Kraftwerke gebaut werden – und zwar fossil betriebene.
Zu den Fehlern der EU-Strommarktöffnung, aus denen die Schweiz lernen kann. Hauptpunkt: Versorgungssicherheit geht vor Preis – etwas teurer dafür garantiert Strom ist besser.
Zu den Fehlern der EU-Strommarktöffnung, aus denen die Schweiz lernen kann. Hauptpunkt: Versorgungssicherheit geht vor Preis – etwas teurer dafür garantiert Strom ist besser.
Leuenberger will eine globale CO2-Abgabe (Effekthascherei).
Leuenberger will eine globale CO2-Abgabe (Effekthascherei).
Warum das Kyoto-Protokoll vielleicht gar nicht so gut ist.
Warum das Kyoto-Protokoll vielleicht gar nicht so gut ist.
Zahlen zum Einsparungspotential des Minergie-Programms (Energieverbrauch und -kosten im Wohnbereich).
Zahlen zum Einsparungspotential des Minergie-Programms (Energieverbrauch und -kosten im Wohnbereich).
Die Schweizer Stromverteilungsnetze sind offenbar weniger robust als erwartet: vor einem Jahr kam es beinahe zu einem Blackout.
Die Schweizer Stromverteilungsnetze sind offenbar weniger robust als erwartet: vor einem Jahr kam es beinahe zu einem Blackout.
Die Internationale Energieagentur präsentiert eine umfassende Studie über die zu erwartenden Versorgungsprobleme und plädiert dafür, erneuerbare Energie und Kernkraft auszubauen. Ansonsten drohe Energieknappheit, die damit verbundene schädigende kurzfristige Deckung der…
Die Internationale Energieagentur präsentiert eine umfassende Studie über die zu erwartenden Versorgungsprobleme und plädiert dafür, erneuerbare Energie und Kernkraft auszubauen. Ansonsten drohe Energieknappheit, die damit verbundene schädigende kurzfristige Deckung der Energielücke (Abholzung etc.) und einer Verschärfung des CO2-Problems. Zudem finden sich Zahlen über die Investitionen in die Energieversorgung gegliedert nach Grossregionen.
Bericht über einen neuen Blackout in Mitteleuropa, ausgehend von Deutschland – doch Hauptbetroffener war Frankreich. In der NZZ vom 16.11.06 wird dann menschliches Versagen als Hauptursache genannt.
Bericht über einen neuen Blackout in Mitteleuropa, ausgehend von Deutschland – doch Hauptbetroffener war Frankreich. In der NZZ vom 16.11.06 wird dann menschliches Versagen als Hauptursache genannt.
Bericht im Vorfeld der zwölften Klimakonferenz in Nairobi inklusive Zahlen zum Anteil der verschiedenen Staaten an den Treibhausgas-Emissionen gemäss Kyoto-Protokoll.
Bericht im Vorfeld der zwölften Klimakonferenz in Nairobi inklusive Zahlen zum Anteil der verschiedenen Staaten an den Treibhausgas-Emissionen gemäss Kyoto-Protokoll.
Forderung nach einer Öffnung des Marktes für Erdgas in der Schweiz parallel zur Strommarktöffnung, weil Gaskraftwerke die einzig realistische Option für eine kurzfristig realisierbare Stromproduktion sei.
Forderung nach einer Öffnung des Marktes für Erdgas in der Schweiz parallel zur Strommarktöffnung, weil Gaskraftwerke die einzig realistische Option für eine kurzfristig realisierbare Stromproduktion sei.
Australische Unternehmen wünschen eine Beteiligung am Emissionshandel.
Australische Unternehmen wünschen eine Beteiligung am Emissionshandel.
Ein Blick auf den CO2-Markt uns seine Tücken.
Ein Blick auf den CO2-Markt uns seine Tücken.
Schweden startet ein aggressives Programm, um weg vom Erdöl zu kommen. Bio-Brennstoffe gelten hier als Zukunft – was bedeutet das für die schwedischen Wälder?
Schweden startet ein aggressives Programm, um weg vom Erdöl zu kommen. Bio-Brennstoffe gelten hier als Zukunft – was bedeutet das für die schwedischen Wälder?
Kurzer Bericht über ein Forschungsprojekt der ETH Zürich, das den steigenden Energieverbrauch in Indien und China prognostizieren will (interessant, nachfragen, falls nötig).
Kurzer Bericht über ein Forschungsprojekt der ETH Zürich, das den steigenden Energieverbrauch in Indien und China prognostizieren will (interessant, nachfragen, falls nötig).
Erneute Prognose der Stromlücke für 2020. Prognosesicherheit besteht vorab im Bereich sinkendes Angebot, wegen den abzuschaltenden AKWs und den auslaufenden Verträgen mit Frankreich. Letztere lassen sich nicht so einfach ersetzen,…
Erneute Prognose der Stromlücke für 2020. Prognosesicherheit besteht vorab im Bereich sinkendes Angebot, wegen den abzuschaltenden AKWs und den auslaufenden Verträgen mit Frankreich. Letztere lassen sich nicht so einfach ersetzen, da europaweit langfristig Lieferengpässe auftreten werden. Selbst wenn man mit Energiesparmassnahmen das Nachfragewachstum plafonieren könnte, haben wir ein Problem.
Zu den Problemen des CO2-Marktes, nachdem bekannt geworden ist, dass viele Zertifikate nicht verkauft werden konnten, weil die Regierungen aus politischen Gründen zu viel Zertifikate rausgegeben haben. Siehe dazu auch…
Zu den Problemen des CO2-Marktes, nachdem bekannt geworden ist, dass viele Zertifikate nicht verkauft werden konnten, weil die Regierungen aus politischen Gründen zu viel Zertifikate rausgegeben haben. Siehe dazu auch die BaZ vom 26.05.06.
Eine Beurteilung der Kosten von CO2-freien Energien: die Sache könnte billiger sein als man denkt.
Eine Beurteilung der Kosten von CO2-freien Energien: die Sache könnte billiger sein als man denkt.
Skizze der Umweltorganisationen zur Energieversorgung im Jahr 2050. Kern ist das Absenken des Energieverbrauchs um 2/3 (2000 Watt Gesellschaft). Dazu würden aber der konsequente Einsatz der jetzt bestmöglichen Technologie nicht…
Skizze der Umweltorganisationen zur Energieversorgung im Jahr 2050. Kern ist das Absenken des Energieverbrauchs um 2/3 (2000 Watt Gesellschaft). Dazu würden aber der konsequente Einsatz der jetzt bestmöglichen Technologie nicht ausreichen. Die Haupteinsparung würde eine starke Einschränkung der Mobilität verlangen (wie stark wird nicht ausgeführt). Zudem sollen drei Viertel der 2000 Watt aus erneuerbaren Quellen stammen (eine Verdreifachung des Anteils). Letztlich wird also ein Bruch der bisherigen Kopplung von Energieverbrauch und den Vorstellungen von Fortschritt und Wachstum verlangt – das ist bei weitem nicht nur ein technologisches Projekt.
Die Verknappung des Erdöls wird mit der Hoffnung auf ein Ende des Kapitalismus verknüpft. Dem Artikel liegt eine Fehlinterpretation von Kapitalismus zugrunde bzw. die programmatische Verknüpfung von Kapitalismus und fossiler…
Die Verknappung des Erdöls wird mit der Hoffnung auf ein Ende des Kapitalismus verknüpft. Dem Artikel liegt eine Fehlinterpretation von Kapitalismus zugrunde bzw. die programmatische Verknüpfung von Kapitalismus und fossiler Energie. Es Es liegt durchaus in der Natur des Kapitalismus, dass sich dessen Wachstumsdynamik auf andere Bereiche umlagert, die weniger auf fossile Energie abhängt. Die Kapitalismuskritik macht es sich zu einfach, wenn man diesen einfach mit etwas „schlechtem“ (wie Fossilenergie) verknüpft und im Wissen, dass diese Energien einmal zu Ende gehen gleich das Ende des Kapitalismus prognostizieren. so ist das einfach eine Tautologie. Zudem sind einzelne Aspekte auch faktisch falsch, z.B. die Bemerkungen zur Energiespeicherung (auch nichtfossile Energien lassen sich speichern).
Zu den Energieperspektiven des Bundes: Man rechnet mit steigendem Energiebedarf. Der temporäre Ausfall von Leibstatt hat zudem gezeigt, wie die Lücke entsteht: Erstmals war 2005 der Gesamtverbrauch grösser als die…
Zu den Energieperspektiven des Bundes: Man rechnet mit steigendem Energiebedarf. Der temporäre Ausfall von Leibstatt hat zudem gezeigt, wie die Lücke entsteht: Erstmals war 2005 der Gesamtverbrauch grösser als die Gesamtproduktion, da Strom in Europa knapper wird, wird das teuer. Ab 2010 wird das immer öfter vorkommen, ab 2020 wird endgültig zu wenig Strom da sein, weil Mühleberg, und die beiden Beznau abgestellt werden, so der Bund. Selbst bei starken Sparmassnahmen werden Probleme auftauchen, so die Szenarien.
Eine richtige Bemerkung: nicht CO2-Abgabe und Klimarappen werden das energiepolitische Umdenken bewirken, sondern die hohen Gas- und Ölpreise.
Eine richtige Bemerkung: nicht CO2-Abgabe und Klimarappen werden das energiepolitische Umdenken bewirken, sondern die hohen Gas- und Ölpreise.
Recht umfassende Übersicht zu den derzeitigen Wandlungen in der europäischen Energieversorgung: Zunehmende Ostabhängigkeit, mögliche Renaissance der Kohle und Kernenergie, Problematik der Transportkapazität bei Marktöffnung.
Recht umfassende Übersicht zu den derzeitigen Wandlungen in der europäischen Energieversorgung: Zunehmende Ostabhängigkeit, mögliche Renaissance der Kohle und Kernenergie, Problematik der Transportkapazität bei Marktöffnung.
Wie die Europäer auf Russlands Gas-Muskelspiele reagieren: Diversifizierung. Wichtig zudem: die Russen selbst wollen die Atomkraft wieder forcieren: 40 neue Reaktoren.
Wie die Europäer auf Russlands Gas-Muskelspiele reagieren: Diversifizierung. Wichtig zudem: die Russen selbst wollen die Atomkraft wieder forcieren: 40 neue Reaktoren.
Pro und Kontra-Argumente für die CO2-Abgabe.
Pro und Kontra-Argumente für die CO2-Abgabe.
Zum Stromnetzproblem von Österreich (und Europa insgesamt): Die Leute wehren sich gegen die Leitungen, wollen die damit aber einhergehende Netz-Instabilität auch nicht akzeptieren. Man sollte auf Kabel setzten, die offenbar…
Zum Stromnetzproblem von Österreich (und Europa insgesamt): Die Leute wehren sich gegen die Leitungen, wollen die damit aber einhergehende Netz-Instabilität auch nicht akzeptieren. Man sollte auf Kabel setzten, die offenbar gar nicht so viel teurer sind als Freileitungen, wenn man die Betriebskosten mitberücksichtigt.
Warum Klimaschutz auch für die Industrie interessant sein könnte - vorab im Hinblick auf Energieeffizienz.
Warum Klimaschutz auch für die Industrie interessant sein könnte - vorab im Hinblick auf Energieeffizienz.
Debatte der Frage, ob man die Treibstoffzölle wegen der höheren Rohölpreise senken solle.
Debatte der Frage, ob man die Treibstoffzölle wegen der höheren Rohölpreise senken solle.
Zur Problematik der Anpassung der europäischen Strom-Strukturen (Netzinfrastruktur, Institutionen): diese entstanden in einer Zeit, als kaum grenzüberschreitend Strom produziert wurde. Neue Energien mit anderen Zykluszeiten (wie Wind) werden nun aber…
Zur Problematik der Anpassung der europäischen Strom-Strukturen (Netzinfrastruktur, Institutionen): diese entstanden in einer Zeit, als kaum grenzüberschreitend Strom produziert wurde. Neue Energien mit anderen Zykluszeiten (wie Wind) werden nun aber grenzüberschreitende Netze im grossen Stil verlangen. Anpassungszeit: 20-50 Jahre.
Wie eine Überregulierung dazu führen werde, dass die Schweiz die Kyoto-Ziele nicht erreichen werde.
Wie eine Überregulierung dazu führen werde, dass die Schweiz die Kyoto-Ziele nicht erreichen werde.
Wie CO2-Abgabe in Kombination mit dem Emissionshandel effektiv sein könne.
Wie CO2-Abgabe in Kombination mit dem Emissionshandel effektiv sein könne.
Wie sich die Schweizer Wirtschaft das CO2-Gesetz wünscht.
Wie sich die Schweizer Wirtschaft das CO2-Gesetz wünscht.
Präsentation des Konzepts des Emissionshandels.
Präsentation des Konzepts des Emissionshandels.
Eine Übersicht über den Emissionshandel.
Eine Übersicht über den Emissionshandel.
Ein vertiefender Blick auf den Emissionshandel.
Ein vertiefender Blick auf den Emissionshandel.
Wissenschaftliche Probleme der Umsetzung des Kyoto-Protokolls: vorab die Bestimmung des Beitrags der natürlichen Quellen und Senken.
Wissenschaftliche Probleme der Umsetzung des Kyoto-Protokolls: vorab die Bestimmung des Beitrags der natürlichen Quellen und Senken.
Übersicht über die verschiedenen Massnahmen zum Klimaschutz in der Schweiz.
Übersicht über die verschiedenen Massnahmen zum Klimaschutz in der Schweiz.
Zum Netzzusammenbruch in Italien: Ausdruck eines gesamteuropäischen Problems: Infrastruktur und Kooperation sind zuwenig gut ausgebaut.
Zum Netzzusammenbruch in Italien: Ausdruck eines gesamteuropäischen Problems: Infrastruktur und Kooperation sind zuwenig gut ausgebaut.
Warum das Beratende Organ für Fragen der Klimaänderung des Bundes (OcCC) die CO2-Abgabe dem Klimarappen vorzieht.
Warum das Beratende Organ für Fragen der Klimaänderung des Bundes (OcCC) die CO2-Abgabe dem Klimarappen vorzieht.
Kurze Übersicht zu passiv-Energiehäuser.
Kurze Übersicht zu passiv-Energiehäuser.
Zu den Blackouts in Italien und New York: Bei Italien wäre fast ganz Mitteleuropa betroffen gewesen, wenn nicht sechs französische und deutsche Grosskraftwerke sofort abgestellt worden wären. Markt wird als…
Zu den Blackouts in Italien und New York: Bei Italien wäre fast ganz Mitteleuropa betroffen gewesen, wenn nicht sechs französische und deutsche Grosskraftwerke sofort abgestellt worden wären. Markt wird als zusätzliches Problem identifiziert, weil nun Geld für langfristige Investitionen fehlt.
Erneut zu den Blackouts: Offenbar ist das Netzwerk selbst instabil, denn die Generatoren werden so stark wie möglich ausgelastet, so dass es an Sicherheitsreserven fehlt. Zudem gibt es positive Rückkopplungen,…
Erneut zu den Blackouts: Offenbar ist das Netzwerk selbst instabil, denn die Generatoren werden so stark wie möglich ausgelastet, so dass es an Sicherheitsreserven fehlt. Zudem gibt es positive Rückkopplungen, denn die Sicherheitssysteme der Kraftwerke brauchen auch Strom. Fehlt dieser, schalten die Kraftwerke ab und die Strommenge sinkt noch mehr.
Rechsteiners Szenario für die Energieversorgung im Jahr 2033: Wo er sich meines Erachtens irrt ist: Kohle wird wieder bedeutsam und auch Atomkraft wird vorab in Indien und China gepusht. Denkbar…
Rechsteiners Szenario für die Energieversorgung im Jahr 2033: Wo er sich meines Erachtens irrt ist: Kohle wird wieder bedeutsam und auch Atomkraft wird vorab in Indien und China gepusht. Denkbar ist aber, das Windkraft etwa die Grössenordnung erreicht, die er annimmt. Richtig ist auch die Vermutung, dass Wasserstoff keine Rolle spielen wird.
Bericht zum Blackout in Italien: Vier Ursachen werden genannt: Der Kurzschluss bei der Lukmanier-Leitung, mangelndes Bewusstsein der Dringlichkeit der Situation, instabiles italienisches Netz und eventuell standen die Schweizer Bäume zu…
Bericht zum Blackout in Italien: Vier Ursachen werden genannt: Der Kurzschluss bei der Lukmanier-Leitung, mangelndes Bewusstsein der Dringlichkeit der Situation, instabiles italienisches Netz und eventuell standen die Schweizer Bäume zu nahe bei den Leitungen als erlaubt
Stellungnahme zum Argument, die Stromliberalisierung sei an den Blackouts schuld. Zum einen können auch staatliche Unternehmen nicht investieren (Beispiel: SBB), zum anderen würden durch die Schweizer Kraftwerke durchaus viel investiert.…
Stellungnahme zum Argument, die Stromliberalisierung sei an den Blackouts schuld. Zum einen können auch staatliche Unternehmen nicht investieren (Beispiel: SBB), zum anderen würden durch die Schweizer Kraftwerke durchaus viel investiert. Das Problem Italien sei schon lange bekannt: Atomausstieg ohne Ersatzkapazität führt dazu, dass 20% des Stroms über nur wenige Leitungen importiert werden müssten.
Kiener wehrt sich hier für „Energie Schweiz“.
Kiener wehrt sich hier für „Energie Schweiz“.
Eine positive Beurteilung der Einführung eines Klimarappens in der Schweiz.
Eine positive Beurteilung der Einführung eines Klimarappens in der Schweiz.
Eine Studie über die Risiken der Marktöffnung von Ecoplan, 21 werden genannt, die wichtigsten betreffen die langfristige Kapazitätsplanung und Investitionen sowie die Preistransparenz.
Eine Studie über die Risiken der Marktöffnung von Ecoplan, 21 werden genannt, die wichtigsten betreffen die langfristige Kapazitätsplanung und Investitionen sowie die Preistransparenz.
In den einzelnen Gliedstaaten macht man trotz der Weigerung der US-Regierung, dem Kyoto-Protokoll beizutreten, Ernst mit dem Klimaschutz.
In den einzelnen Gliedstaaten macht man trotz der Weigerung der US-Regierung, dem Kyoto-Protokoll beizutreten, Ernst mit dem Klimaschutz.
Argumente der Wirtschaftslobby für die Strommarktöffnung – genützt hat’s bekanntlich nichts.
Argumente der Wirtschaftslobby für die Strommarktöffnung – genützt hat’s bekanntlich nichts.
Ein interessanter Aspekt: die Tribologie, die Lehre der Reibung und Schmierung: Wenn man das richtig macht, kann man recht viel an Energie gewinnen und Verschleiss vermindern (letztlich auch eine Energieeinsparung).…
Ein interessanter Aspekt: die Tribologie, die Lehre der Reibung und Schmierung: Wenn man das richtig macht, kann man recht viel an Energie gewinnen und Verschleiss vermindern (letztlich auch eine Energieeinsparung). Hätte dazu gerne eine Abschätzung.
Zum CO2-Gesetz: Was Kyoto für die Schweiz bedeuten kann: Lancierung eines nationalen Emissionshandels.
Zum CO2-Gesetz: Was Kyoto für die Schweiz bedeuten kann: Lancierung eines nationalen Emissionshandels.
Bisherige Erfahrungen mit dem Emissionshandel.
Bisherige Erfahrungen mit dem Emissionshandel.
Hinweis darauf, dass das CO2-Gesetz seine Ziele (Emissions-Reduktion) wohl nicht erreichen wird (was sich ja dann auch bewahrheitet hat).
Hinweis darauf, dass das CO2-Gesetz seine Ziele (Emissions-Reduktion) wohl nicht erreichen wird (was sich ja dann auch bewahrheitet hat).
Fünf Gründe, warum Bush das Kyoto-Protokoll ablehnt. Einige sind bedenkenswert.
Fünf Gründe, warum Bush das Kyoto-Protokoll ablehnt. Einige sind bedenkenswert.
Einige Zahlen zum Ökostrom-Markt: europaweit gibt es rund 300 Anbieter, die eine Million Kunden beliefern – sicher noch ein Nischenmarkt. Die grössten Zahlen finden sich in den liberalisierten Märkten.
Einige Zahlen zum Ökostrom-Markt: europaweit gibt es rund 300 Anbieter, die eine Million Kunden beliefern – sicher noch ein Nischenmarkt. Die grössten Zahlen finden sich in den liberalisierten Märkten.
Eine Beurteilung der globalen Energie- und Klimapolitik aus Schweizer Sicht.
Eine Beurteilung der globalen Energie- und Klimapolitik aus Schweizer Sicht.
Hinweis auf ein Grundproblem der Amerikaner: Energieverbrauch war über Jahrzehnte kein Thema – das hat Spuren in Städtebau, Architektur und Verkehrsinfrastruktur hinterlassen, wofür die Amerikaner einmal bitter bezahlen werden.
Hinweis auf ein Grundproblem der Amerikaner: Energieverbrauch war über Jahrzehnte kein Thema – das hat Spuren in Städtebau, Architektur und Verkehrsinfrastruktur hinterlassen, wofür die Amerikaner einmal bitter bezahlen werden.
Zum Rücktritt von Kiener – den hab ich mal interviewt.
Zum Rücktritt von Kiener – den hab ich mal interviewt.
Eine Einschätzung der Internationalen Energieagentur: Gemäss ihren Schätzungen werden die erneuerbaren Energien (ohne Wasserkraft) 2020 nicht mehr als weltweit 3% der Energie liefern. Übrigens aufpassen bei Vergleichen: Totalenergie ist nicht…
Eine Einschätzung der Internationalen Energieagentur: Gemäss ihren Schätzungen werden die erneuerbaren Energien (ohne Wasserkraft) 2020 nicht mehr als weltweit 3% der Energie liefern. Übrigens aufpassen bei Vergleichen: Totalenergie ist nicht gleich Strom.
Perrin behauptet: die Gesamtenergiestatistik enthalte systematische Fehler, weil die Wattzahl der Primärenergie mit dem Strom addiert würden, der ja keine Primärenergie ist sondern aus einem Mix von Primärenergien gewonnen wird.…
Perrin behauptet: die Gesamtenergiestatistik enthalte systematische Fehler, weil die Wattzahl der Primärenergie mit dem Strom addiert würden, der ja keine Primärenergie ist sondern aus einem Mix von Primärenergien gewonnen wird. Das ergibt dann etwa 40-50% mehr Energie, die verbraucht wird! Und das Bundesamt gibt das auch noch zu.
Argumente dafür, dass die Strommarktöffnung letztlich zu höheren Preisen führen werde. Und der Hinweis darauf, dass der teure Ökostrom den weniger sauberen Billigstrom subventionieren würde.
Argumente dafür, dass die Strommarktöffnung letztlich zu höheren Preisen führen werde. Und der Hinweis darauf, dass der teure Ökostrom den weniger sauberen Billigstrom subventionieren würde.
Eine offene Frage des Kyoto-Protokolls: wie ist der Beitrag der Wälder in der Emissionsbilanz einzubeziehen?
Eine offene Frage des Kyoto-Protokolls: wie ist der Beitrag der Wälder in der Emissionsbilanz einzubeziehen?
Vorschau auf die Klimakonferenz in Den Haag.
Vorschau auf die Klimakonferenz in Den Haag.
Kritik am Strommarktgesetz: vorab die energieintensiven KMU kommen unter die Räder.
Kritik am Strommarktgesetz: vorab die energieintensiven KMU kommen unter die Räder.
Eine Beurteilung des Emissionshandels.
Eine Beurteilung des Emissionshandels.
Einige Hinweise darauf, wie man vom fossil erzeigten Strom wegkommen könnte: Effizienzsteigerung, Erhalt der Wasserkraft, Förderung erneuerbarer Energien. Eher eine Absichtserklärung denn ein klares Konzept.
Einige Hinweise darauf, wie man vom fossil erzeigten Strom wegkommen könnte: Effizienzsteigerung, Erhalt der Wasserkraft, Förderung erneuerbarer Energien. Eher eine Absichtserklärung denn ein klares Konzept.
Binswanger formuliert seine Idee der ökologischen Steuerreform im Kontext der Energie-Abstimmungen: Zu viel Förderung à la Solarinitiative ist falsch – was ich unterstütze.
Binswanger formuliert seine Idee der ökologischen Steuerreform im Kontext der Energie-Abstimmungen: Zu viel Förderung à la Solarinitiative ist falsch – was ich unterstütze.
Einige kritische Bemerkungen zum Konzept der ökologischen Steuerreform durch Kohn: Ein Grundkonstruktionsfehler ist, dass – sobald die Steuerreform ihren erwünschten Effekt hat (weniger Energieverbrauch = weniger Steuereinnahmen) – die Lohnnebenkosten…
Einige kritische Bemerkungen zum Konzept der ökologischen Steuerreform durch Kohn: Ein Grundkonstruktionsfehler ist, dass – sobald die Steuerreform ihren erwünschten Effekt hat (weniger Energieverbrauch = weniger Steuereinnahmen) – die Lohnnebenkosten nicht mehr reduziert werden können. Zudem wird damit die arbeitsintensive Dienstleistungsbranche bevorzugt, die für die Wertschöpfung aber wichtigere Exportindustrie vernachlässigt.
Weitere Stimme im Streit um die ökologische Steuerreform: Es gebe eine doppelte Dividende, weil die externen Kosten internalisiert würden – bin da nicht so sicher, vorab weil die externen Kosten…
Weitere Stimme im Streit um die ökologische Steuerreform: Es gebe eine doppelte Dividende, weil die externen Kosten internalisiert würden – bin da nicht so sicher, vorab weil die externen Kosten ein rechter Gummibegriff sind.
Zu diesem Zeitpunkt deckt China seinen Energiebedarf mit Kohle, was natürlich Kyoto faktisch begraben wird. Doch die Chinesen werden ihre Energiepolitik schneller ändern als dies der Westen getan hat. Lassen…
Zu diesem Zeitpunkt deckt China seinen Energiebedarf mit Kohle, was natürlich Kyoto faktisch begraben wird. Doch die Chinesen werden ihre Energiepolitik schneller ändern als dies der Westen getan hat. Lassen wir uns also einmal überraschen.
Zum Streit um die doppelte Dividende: Hier wehrt sich Ecoplan – und eine Replik.
Zum Streit um die doppelte Dividende: Hier wehrt sich Ecoplan – und eine Replik.
Kritischer Blick auf die so genannte doppelte Dividende. Eigentlich haben die Öko-orientierten das ökonomische win-win aufnehmen wollen, das es wohl nur dann gibt, wenn sich die Perspektiven auf das Problem…
Kritischer Blick auf die so genannte doppelte Dividende. Eigentlich haben die Öko-orientierten das ökonomische win-win aufnehmen wollen, das es wohl nur dann gibt, wenn sich die Perspektiven auf das Problem unterscheiden.
Hintergründe und Vorgeschichte des Kyoto-Protokolls.
Hintergründe und Vorgeschichte des Kyoto-Protokolls.
Interessantes zu den Verknüpfungen bei den Schweizer Stromunternehmen.
Interessantes zu den Verknüpfungen bei den Schweizer Stromunternehmen.
Eine Evaluation von verschiedenen energiepolitischen Instrumenten durch die politischen Akteure: Wärmedämmvorschriften sind am beliebtesten.
Eine Evaluation von verschiedenen energiepolitischen Instrumenten durch die politischen Akteure: Wärmedämmvorschriften sind am beliebtesten.
Prognose der Clean Energy 2000 Konferenz: Man könnte den globalen Energieverbrauch rein mit Erneuerbaren Energien plus Erdwärme decken – wenn man bereit ist, den Preis dafür zu zahlen. An eine…
Prognose der Clean Energy 2000 Konferenz: Man könnte den globalen Energieverbrauch rein mit Erneuerbaren Energien plus Erdwärme decken – wenn man bereit ist, den Preis dafür zu zahlen. An eine globale Wasserstoffwirtschaft glaube ich aber nicht.
Was die Liberalisierung auch bringen könnte: der Strommarkt wird sich dahingehend verändern, dass diese Firmen auch neue Produkte anbieten wie z.B. Telekommunikation und Internet.
Was die Liberalisierung auch bringen könnte: der Strommarkt wird sich dahingehend verändern, dass diese Firmen auch neue Produkte anbieten wie z.B. Telekommunikation und Internet.
Platter mit seiner Ansicht zu den Energieabgaben.
Platter mit seiner Ansicht zu den Energieabgaben.
Ende der 1980er Jahre wurde eine Stromlücke prognostiziert, die es dann aber nie gegeben hat. Im Gegenteil: es wurden Überkapazitäten aufgebaut. Ein Schönes Beispiel, wie falsch Prognosen bezüglich Produktion und…
Ende der 1980er Jahre wurde eine Stromlücke prognostiziert, die es dann aber nie gegeben hat. Im Gegenteil: es wurden Überkapazitäten aufgebaut. Ein Schönes Beispiel, wie falsch Prognosen bezüglich Produktion und Bedarf sein können.
Zu den diversen Schwierigkeiten der alternativen Energien: Hier findet sich eine Prognose für Solarstrom bis 2050: 6-11% Anteil am Weltenergieverbrauch (inkl. solarthermische Kraftwerke). Realistisch nach PSI ist für 2050 ein…
Zu den diversen Schwierigkeiten der alternativen Energien: Hier findet sich eine Prognose für Solarstrom bis 2050: 6-11% Anteil am Weltenergieverbrauch (inkl. solarthermische Kraftwerke). Realistisch nach PSI ist für 2050 ein Anteil der erneuerbaren Energien (inkl. Wasserkraft) von einem guten Drittel.
Zur Rolle der fossilen Energie in der Debatte um Nachhaltigkeit.
Zur Rolle der fossilen Energie in der Debatte um Nachhaltigkeit.
Energiepolitik ist Subventionspolitik von teilweise weit mehr umstrittenen Energieformen als man gemeinhin denkt.
Energiepolitik ist Subventionspolitik von teilweise weit mehr umstrittenen Energieformen als man gemeinhin denkt.
Zum „Doppelspiel“ der Schweizer Stromunternehmen, die im sich liberalisierenden europäischen Markt den Strom billiger anbieten als in der Schweiz – was man zu einem Argument pro Liberalisierung ummodeln könnte, oder?
Zum „Doppelspiel“ der Schweizer Stromunternehmen, die im sich liberalisierenden europäischen Markt den Strom billiger anbieten als in der Schweiz – was man zu einem Argument pro Liberalisierung ummodeln könnte, oder?
Einige Schwachstellen der ökologischen Steuerreform: Um die Lohnnebenkosten um ein Prozent zu senken, müssten gemäss dieser Rechnung eine Abgabe von rund 20% eingeführt werden.
Einige Schwachstellen der ökologischen Steuerreform: Um die Lohnnebenkosten um ein Prozent zu senken, müssten gemäss dieser Rechnung eine Abgabe von rund 20% eingeführt werden.
Dick Marty befürwortet den Energieabgabebeschluss des Nationalrates, die Argumente sind OK.
Dick Marty befürwortet den Energieabgabebeschluss des Nationalrates, die Argumente sind OK.
Fischer warnt davor, dass im Energiebereich ein ähnlicher Subventionsdschungel aufgebaut wird wie in der Landwirtschaft. Er hat insofern recht, als dass im System Schweiz ein einmal errichteter Subventionsdschungel kaum mehr…
Fischer warnt davor, dass im Energiebereich ein ähnlicher Subventionsdschungel aufgebaut wird wie in der Landwirtschaft. Er hat insofern recht, als dass im System Schweiz ein einmal errichteter Subventionsdschungel kaum mehr gerodet wird – siehe Landwirtschaft.
Rechsteiners Anmerkungen zur Energiepolitik: Ja, der Preis der fossilen Energie entscheidet darüber, wann der Umbau beginnt. Und der muss wohl oder übel weltweit steigen.
Rechsteiners Anmerkungen zur Energiepolitik: Ja, der Preis der fossilen Energie entscheidet darüber, wann der Umbau beginnt. Und der muss wohl oder übel weltweit steigen.
Eine weitere Zahl im Umweltstreit: Hohe Umweltschutzabgaben würden Produktionskosten nur geringfügig erhöhen – das Argument hier scheint mir aber recht löchrig.
Eine weitere Zahl im Umweltstreit: Hohe Umweltschutzabgaben würden Produktionskosten nur geringfügig erhöhen – das Argument hier scheint mir aber recht löchrig.
Eigentlich ein typischer Wissenschaftlertext. Umbau der Energiepolitik ist eine langfristige Angelegenheit – was wir ja alle wissen. Doch was konkret soll man tun?
Eigentlich ein typischer Wissenschaftlertext. Umbau der Energiepolitik ist eine langfristige Angelegenheit – was wir ja alle wissen. Doch was konkret soll man tun?
Die Bergkantone wollen den Wasserzins behalten – erstaunt ja nicht, sie verdienen daran.
Die Bergkantone wollen den Wasserzins behalten – erstaunt ja nicht, sie verdienen daran.
Eine Reihe von Autoren pro Förderung von Alternativenergien – und eine Replik von Binswanger. Seine Bedenken haben durchaus ihre Rechtfertigung.
Eine Reihe von Autoren pro Förderung von Alternativenergien – und eine Replik von Binswanger. Seine Bedenken haben durchaus ihre Rechtfertigung.
Zur ökologischen Steuerreform in Deutschland: Unternehmen mit hoher Abwanderungsneigung werden offenbar nicht besteuert.
Zur ökologischen Steuerreform in Deutschland: Unternehmen mit hoher Abwanderungsneigung werden offenbar nicht besteuert.
Zu den Ergebnissen der Klimakonferenz von Buenos Aires.
Zu den Ergebnissen der Klimakonferenz von Buenos Aires.
Stand der Dinge in der Diskussion um die ökologische Steuerreform.
Stand der Dinge in der Diskussion um die ökologische Steuerreform.
Eine kritische Beurteilung des Handels mit Verschmutzungszertifikaten.
Eine kritische Beurteilung des Handels mit Verschmutzungszertifikaten.
Eine Vorschau auf die Klimakonferenz von Buenos Aires.
Eine Vorschau auf die Klimakonferenz von Buenos Aires.
Zur Verbindung von Energie- und Klimapolitik in der Schweiz.
Zur Verbindung von Energie- und Klimapolitik in der Schweiz.
Eine Zusammenstellung aller Vorlagen, die die Energie besteuern wollen. Dürfte bei einem Rückblick interessant sein.
Eine Zusammenstellung aller Vorlagen, die die Energie besteuern wollen. Dürfte bei einem Rückblick interessant sein.