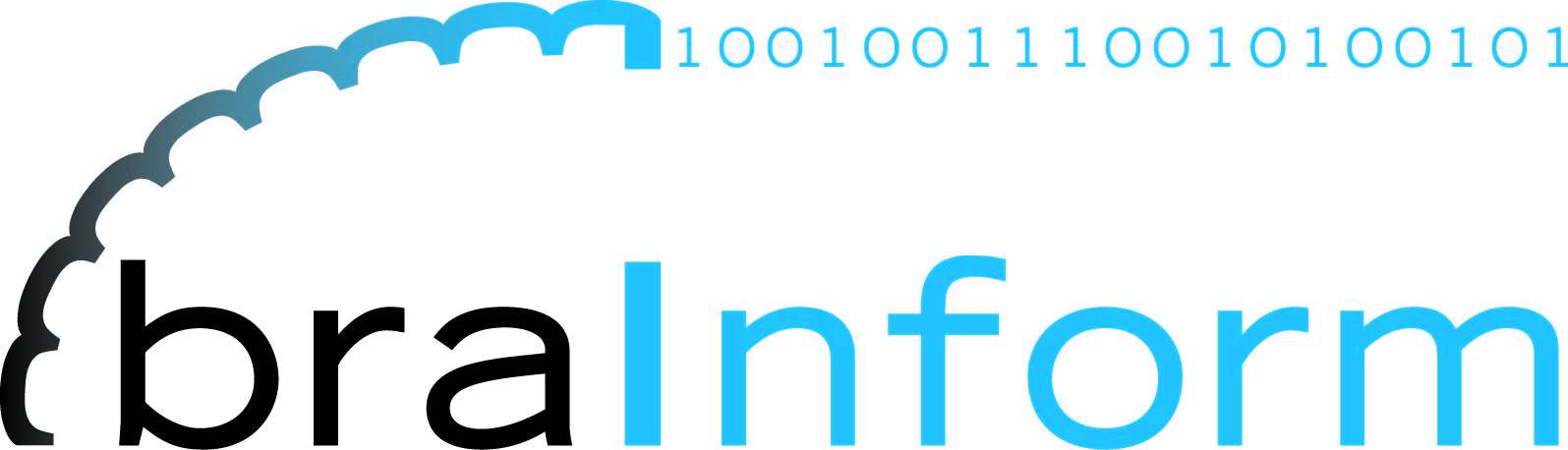Es gibt immer mehr erfundene Studien in der Wissenschaft - mal schauen, wie das die KI-Systeme verseuchen wird.
Es gibt immer mehr erfundene Studien in der Wissenschaft - mal schauen, wie das die KI-Systeme verseuchen wird.
Wie man bei der Jagd auf Plagiate übertreiben kann.
Wie man bei der Jagd auf Plagiate übertreiben kann.
Mehrere Alzheimer-Studien sind systematisch gefälscht worden; dies führte zur falschem Amyloid-Hypothese.
Mehrere Alzheimer-Studien sind systematisch gefälscht worden; dies führte zur falschem Amyloid-Hypothese.
Wie Falschinformationen über einen Konferenzbeitrag in den Sozialen Medien aus einem Wurmmittel ein Covid-Wundermittel machte.
Wie Falschinformationen über einen Konferenzbeitrag in den Sozialen Medien aus einem Wurmmittel ein Covid-Wundermittel machte.
Wie Privatpersonen gegen Schummelei in der Wissenschaft kämpfen.
Wie Privatpersonen gegen Schummelei in der Wissenschaft kämpfen.
Wie die grossen Wissenschaftsverlage mit Open Access abkassieren.
Wie die grossen Wissenschaftsverlage mit Open Access abkassieren.
Zum Element der Panikmache in der Wissenschaftskommunikation über Corona.
Zum Element der Panikmache in der Wissenschaftskommunikation über Corona.
Beispiele intelligenter Massnahmen der Forschungskommunikation aus der Schweiz. Und Resultate einer Studie die zeigt, dass die Leute aus dem gleichen Datensatz zu ganz unterschiedlichen Schlüssen kommen können, je nach angewandter…
Beispiele intelligenter Massnahmen der Forschungskommunikation aus der Schweiz. Und Resultate einer Studie die zeigt, dass die Leute aus dem gleichen Datensatz zu ganz unterschiedlichen Schlüssen kommen können, je nach angewandter Methode (was aber nicht erstaunt).
Forscher nutzen künstliche Intelligenz für das Schreiben von Publikationen.
Forscher nutzen künstliche Intelligenz für das Schreiben von Publikationen.
Zu den Problemen der wissenschaftlichen Publikationspraxis.
Zu den Problemen der wissenschaftlichen Publikationspraxis.
Wie die Sozialwissenschaften und die Medizin von der Physik lernen können, um ihre Statistiken besser zu verstehen.
Wie die Sozialwissenschaften und die Medizin von der Physik lernen können, um ihre Statistiken besser zu verstehen.
Eine nach Lockdown schreiende Forschung hat etwas Bevormundendes
Eine nach Lockdown schreiende Forschung hat etwas Bevormundendes
Zu den unklaren Motiven der Plagiats-Jäger
Zu den unklaren Motiven der Plagiats-Jäger
In der Schweiz schliessen sich 475 wissenschaftliche Institutionen zu einem gemeinsamen Literaturrecherche-Verbund zusammen.
In der Schweiz schliessen sich 475 wissenschaftliche Institutionen zu einem gemeinsamen Literaturrecherche-Verbund zusammen.
Der Rückruf zweiter Studien aus hochrangigen medizinischen Fachzeitschriften verweist auf altbekannte Probleme, kombiniert mit dem Corona-Erwartungsdruck.
Der Rückruf zweiter Studien aus hochrangigen medizinischen Fachzeitschriften verweist auf altbekannte Probleme, kombiniert mit dem Corona-Erwartungsdruck.
Eine sehr schöne Darstellung des Unterschieds zwischen Korrelation und Kausalität am Beispiel von Covid und den G5-Antennen - so sollte man es machen.
Eine sehr schöne Darstellung des Unterschieds zwischen Korrelation und Kausalität am Beispiel von Covid und den G5-Antennen - so sollte man es machen.
Wie wissenschaftliche Desinformation funktioniert.
Wie wissenschaftliche Desinformation funktioniert.
Eine Analyse der zurückgezogenen Paper zeigt, dass vorab chinesische Forscher betrügen.
Eine Analyse der zurückgezogenen Paper zeigt, dass vorab chinesische Forscher betrügen.
Roboter-Journalisten liefern Zusammenfassungen wissenschaftlicher Studien - das Ergebnis überzeugt noch nicht.
Roboter-Journalisten liefern Zusammenfassungen wissenschaftlicher Studien - das Ergebnis überzeugt noch nicht.
Das Verfahren Sokal gleich mehrfach experimentell geprüft: Fake-Science schafft es zu einem Drittel in Cultural Studies Journals.
Das Verfahren Sokal gleich mehrfach experimentell geprüft: Fake-Science schafft es zu einem Drittel in Cultural Studies Journals.
Der Druck zugunsten von open access nimmt zu.
Der Druck zugunsten von open access nimmt zu.
Warum die Geisteswissenschaftler wieder mehr erzählen sollen, als in ihren Methoden zu versumpfen.
Warum die Geisteswissenschaftler wieder mehr erzählen sollen, als in ihren Methoden zu versumpfen.
Die heutigen Anreize im Wissenschaftssystem führen dazu, dass die Forschung immer sensationslüsterner wird und damit zur allgemeinen Hysterie beiträgt.
Die heutigen Anreize im Wissenschaftssystem führen dazu, dass die Forschung immer sensationslüsterner wird und damit zur allgemeinen Hysterie beiträgt.
Eine Beurteilung der Stellung des Wissenschaftsjournalismus, der zunehmend von PR vereinnahmt wird.
Eine Beurteilung der Stellung des Wissenschaftsjournalismus, der zunehmend von PR vereinnahmt wird.
Warum sich die Forscher mehr in die öffentlichen politischen Diskussionen einmischen sollen.
Warum sich die Forscher mehr in die öffentlichen politischen Diskussionen einmischen sollen.
Beispiel der Auswirkungen einer übertriebenen Plagiatsjagd.
Beispiel der Auswirkungen einer übertriebenen Plagiatsjagd.
Zum zunehmenden Spam der pseudo-Wissenschaftsverlagen.
Zum zunehmenden Spam der pseudo-Wissenschaftsverlagen.
Zu den Risiken der EU-Datencloud für Wissenschaftler.
Zu den Risiken der EU-Datencloud für Wissenschaftler.
Ein Rückblick auf 20 Jahre Open Access in den Wisenschaften
Ein Rückblick auf 20 Jahre Open Access in den Wisenschaften
Geisteswissenschaftler schaffen vermehrt Portale für politische Texte, die sich an die Öffentlichkeit wenden.
Geisteswissenschaftler schaffen vermehrt Portale für politische Texte, die sich an die Öffentlichkeit wenden.
Übersicht über alternative Metriken zur Beurteilung des Forschungs-Outputs: Shares und Likes
Übersicht über alternative Metriken zur Beurteilung des Forschungs-Outputs: Shares und Likes
Wie Wissenschaftler und Universitäten neue Wege suchen, um über ihre Forschung zu berichten.
Wie Wissenschaftler und Universitäten neue Wege suchen, um über ihre Forschung zu berichten.
Übersicht zu Alternativen des Peer Review.
Übersicht zu Alternativen des Peer Review.
Michael Hagner verteidigt das geisteswissenschaftliche Buch gegen open access und andere Tendenzen des "neuen lesens und schreibens".
Michael Hagner verteidigt das geisteswissenschaftliche Buch gegen open access und andere Tendenzen des "neuen lesens und schreibens".
Betrug und Fälschung in der Forschung ist eine Systemeigenschaft des heutigen Forschungsbetriebs.
Betrug und Fälschung in der Forschung ist eine Systemeigenschaft des heutigen Forschungsbetriebs.
Die Verzerrungen von Forschungsresultaten in den Medien ist auf die Öffentlichkeitsstellen der Universitäten zurückzuführen.
Die Verzerrungen von Forschungsresultaten in den Medien ist auf die Öffentlichkeitsstellen der Universitäten zurückzuführen.
Die wissenschaftskommunikation verkommt immer mehr zur Propaganda.
Die wissenschaftskommunikation verkommt immer mehr zur Propaganda.
Ein Plädoyer für open access von Forschungsresultaten der Schweizer Akademien.
Ein Plädoyer für open access von Forschungsresultaten der Schweizer Akademien.
Ein sehr interessanter Beitrag zu Zukunft der Enzyklopädien im digitalen Zeitalter: Gerade die wissenschaftliche Lexikographie sollte und wird (staatlich unterstützt) überleben.
Ein sehr interessanter Beitrag zu Zukunft der Enzyklopädien im digitalen Zeitalter: Gerade die wissenschaftliche Lexikographie sollte und wird (staatlich unterstützt) überleben.
Wie das Peer Review in Zeiten des Open Access erodiert (aber auch deshlab, weil immer mehr publiziert wird).
Wie das Peer Review in Zeiten des Open Access erodiert (aber auch deshlab, weil immer mehr publiziert wird).
Noch ein Beitrag zur Frage, ob der SNF weiterhin geisteswissenschaftliche Bücher drucken soll: die Editionen sollten gedruckt werden.
Noch ein Beitrag zur Frage, ob der SNF weiterhin geisteswissenschaftliche Bücher drucken soll: die Editionen sollten gedruckt werden.
Ein weiterer Debattenbeitrag zur Förderung des Buchdrucks bei den Geisteswissenschaftlern. Hier ein vernünftiger Vorschlag, was gefördert werden sollte, und was nicht.
Ein weiterer Debattenbeitrag zur Förderung des Buchdrucks bei den Geisteswissenschaftlern. Hier ein vernünftiger Vorschlag, was gefördert werden sollte, und was nicht.
Daten zur Internationalität der Schweizer Forschung.
Daten zur Internationalität der Schweizer Forschung.
Warum es richtig ist, dass geisteswissenschaftliche Bücher primär auf Papier gedruckt werden sollten (mit entsprechender Fachkompetenz der Verlage).
Warum es richtig ist, dass geisteswissenschaftliche Bücher primär auf Papier gedruckt werden sollten (mit entsprechender Fachkompetenz der Verlage).
Die Subventionen für geisteswissenschaftliche Bücher gehen oft an Verlage, die Ihre Arbeit schlecht machen. Ein viel grösseres Problem sind aber die Zeitschriften-Konzerne in den Naturwissenschaften - namentlich Springer, Elsevier, Wiley.
Die Subventionen für geisteswissenschaftliche Bücher gehen oft an Verlage, die Ihre Arbeit schlecht machen. Ein viel grösseres Problem sind aber die Zeitschriften-Konzerne in den Naturwissenschaften - namentlich Springer, Elsevier, Wiley.
Es soll 120 computererzeugte Nonsens-Texte geben, die veröffentlicht worden sind - hat auch damit zu tun, das in den Computerwissenschaften Zeitschriften-Publikationen nicht so wichtig sind (und wohl deshalb auch unsorgfältig…
Es soll 120 computererzeugte Nonsens-Texte geben, die veröffentlicht worden sind - hat auch damit zu tun, das in den Computerwissenschaften Zeitschriften-Publikationen nicht so wichtig sind (und wohl deshalb auch unsorgfältig begutachtet werden).
Ein Blick zurück auf die BSE-Krise der 1990er Jahre. Man will nun tierische Eiweisse wieder vermehrt verfüttern.
Ein Blick zurück auf die BSE-Krise der 1990er Jahre. Man will nun tierische Eiweisse wieder vermehrt verfüttern.
Wie man soziale Netzwerke und Dienste wie Twitter für die Forschungskommunikation benutzen kann.
Wie man soziale Netzwerke und Dienste wie Twitter für die Forschungskommunikation benutzen kann.
Wie man Methoden des Textmining in der Literatursuche einsetzt.
Wie man Methoden des Textmining in der Literatursuche einsetzt.
Zur wachsenden Bedeutung von open access (die klassischen Zeitschriften sind schlicht zu teuer).
Zur wachsenden Bedeutung von open access (die klassischen Zeitschriften sind schlicht zu teuer).
Im ersten Jahrzehnt nach 2000 ist die Zahl der zurückgezogenen Paper enorm angestiegen.
Im ersten Jahrzehnt nach 2000 ist die Zahl der zurückgezogenen Paper enorm angestiegen.
Zur Geschichte von ArXiv - ein preprint-Server, der vor 20 Jahren seine Arbeit aufgenommen hat.
Zur Geschichte von ArXiv - ein preprint-Server, der vor 20 Jahren seine Arbeit aufgenommen hat.
Zur Geschichte des vor 50 Jahren erfundenen Science Citation Index.
Zur Geschichte des vor 50 Jahren erfundenen Science Citation Index.
China publiziert zwar am zweitmeisten, aber die Paper werden deutlich seltener zitiert - das sollte ändern.
China publiziert zwar am zweitmeisten, aber die Paper werden deutlich seltener zitiert - das sollte ändern.
Zum Wandel des Wissenschaftsjournalismus, der immer mehr von PR-Meldungen abhängig ist.
Zum Wandel des Wissenschaftsjournalismus, der immer mehr von PR-Meldungen abhängig ist.
Zu den Auswirkung sozialer Netzwerke wie Twitter auf die Beurteilung von Forschungsresultaten.
Zu den Auswirkung sozialer Netzwerke wie Twitter auf die Beurteilung von Forschungsresultaten.
Ein Kommentar, warum wissenschaftliche Beratung die Komplexität der Probleme nicht unterdrücken darf. Und ein zweiter Artikel mit der nicht überraschenden Erkenntnis, das räumlich nahe Labors zum gleichen Thema die Zitationen…
Ein Kommentar, warum wissenschaftliche Beratung die Komplexität der Probleme nicht unterdrücken darf. Und ein zweiter Artikel mit der nicht überraschenden Erkenntnis, das räumlich nahe Labors zum gleichen Thema die Zitationen der Papers erhöht (weil sich die Leute gegenseitig zitieren).
Plädoyer für open access auch von Forschungsprodukten (wie z.B. Zelllinien): diese werden dann deutlich mehr in den Publikationsprozess (Zitationen etc.) eingebunden. In der gleichen Ausgabe ein Bericht über die abnehmende…
Plädoyer für open access auch von Forschungsprodukten (wie z.B. Zelllinien): diese werden dann deutlich mehr in den Publikationsprozess (Zitationen etc.) eingebunden. In der gleichen Ausgabe ein Bericht über die abnehmende Zahl an Mehrfach-Publikationen als Folge der technischen Mittel, solche zu erkennen.
In EMBO werden nicht nur Papers, sondern auch der Peer-Review-Prozess (also Kommentare etc.) publiziert - in der Tat eine interessante Idee.
In EMBO werden nicht nur Papers, sondern auch der Peer-Review-Prozess (also Kommentare etc.) publiziert - in der Tat eine interessante Idee.
Das europäische und das asiatische Publikum von populärwissenschaftlicher Literatur hat sehr unterschiedliche Ansichten zur Rolle der Wissenschaft. Tieferes Vertrauen in Asien, zudem klarere Trennung Wissenschaft/Politik in Asien.
Das europäische und das asiatische Publikum von populärwissenschaftlicher Literatur hat sehr unterschiedliche Ansichten zur Rolle der Wissenschaft. Tieferes Vertrauen in Asien, zudem klarere Trennung Wissenschaft/Politik in Asien.
Zur Debatte über die Grenzen des Peer Review angesichts der Publikationsflut.- Ich sollte das nutzen, um endlich mal meine Ideen dazu zu Papier zu bringen: Journals als nur ein Kommunikationskanal.…
Zur Debatte über die Grenzen des Peer Review angesichts der Publikationsflut.- Ich sollte das nutzen, um endlich mal meine Ideen dazu zu Papier zu bringen: Journals als nur ein Kommunikationskanal. Obergrenzen an Publikationen pro jahr. Umkehrung der Finanzierung (das Forschungsprojekt bezahlt die Publikation, nicht der Leser), etc.
Warum Geisteswissenschaftler Angst vor dem E-Book haben.
Warum Geisteswissenschaftler Angst vor dem E-Book haben.
Wie grosse wissenschaftliche Zeitschriften Plagiate bekämpfen wollen.
Wie grosse wissenschaftliche Zeitschriften Plagiate bekämpfen wollen.
Beurteilung der (wenigen) Zahl an (entdeckten) Plagiatsfällen an der Uni Zürich.
Beurteilung der (wenigen) Zahl an (entdeckten) Plagiatsfällen an der Uni Zürich.
Ein Histogramm der Zahl der Romane mit Wissenschaftlern als Hauptfigur (LabLit.com).
Ein Histogramm der Zahl der Romane mit Wissenschaftlern als Hauptfigur (LabLit.com).
Zum Aufbau eines nationalen Wissensportals durch die grössten Schweizer Bibliotheken.
Zum Aufbau eines nationalen Wissensportals durch die grössten Schweizer Bibliotheken.
Zu den neuen Versuchen in den USA, wissenschaftliche Publikationen möglicht für alle frei zugänglich zu machen. Das ist natürlich der richtige Approach. Ich denke: die Wissenschaftler sollten zahlen für ihre…
Zu den neuen Versuchen in den USA, wissenschaftliche Publikationen möglicht für alle frei zugänglich zu machen. Das ist natürlich der richtige Approach. Ich denke: die Wissenschaftler sollten zahlen für ihre Publikationen in Journals (andere Kommunikationskanäle bleiben frei), bzw. solche Ausgaben sollten fixen Bestandteil von Forschunganträgen sein. Indem man das Publizieren mit Kosten belegt, wird auch weniger Schrott publiziert und man wird Resultate zusammenfassen - es wird weniger und signifikantere Publikationen geben.
Vorschläge zur Verbesserung der Messung von wissenschaftlichem Erfolg.
Vorschläge zur Verbesserung der Messung von wissenschaftlichem Erfolg.
In Deutschland will der DFG die Zahl der Paper, die man bei der Granteingabe angeben soll, deutlich verkleinern.
In Deutschland will der DFG die Zahl der Paper, die man bei der Granteingabe angeben soll, deutlich verkleinern.
Zur Nutzung von Computertechnologie, um sich in der schier endlosen Menge an wissenschaftlichen Publikationen (in PubMed werden bald eine Million Artikel pro jahr dazukommen) zurechtzufinden. Beispiele einer Reihe so genannt…
Zur Nutzung von Computertechnologie, um sich in der schier endlosen Menge an wissenschaftlichen Publikationen (in PubMed werden bald eine Million Artikel pro jahr dazukommen) zurechtzufinden. Beispiele einer Reihe so genannt semantischer Suchmaschinen.
Wie die ETH mit einem Blog Klimaforschung kommunizieren will.
Wie die ETH mit einem Blog Klimaforschung kommunizieren will.
Methoden, wie man Ratschläge und Kommentare von Wissenschaftlern zu aktuellen Fragen "poolen" und damit Entscheidungsfindung fördern kann.
Methoden, wie man Ratschläge und Kommentare von Wissenschaftlern zu aktuellen Fragen "poolen" und damit Entscheidungsfindung fördern kann.
Über den Publikationsdruck in China. UN ein zweiter Artikel über ein Journal, dass offenbar bereits publizierte Arbeiten erneut publiziert.
Über den Publikationsdruck in China. UN ein zweiter Artikel über ein Journal, dass offenbar bereits publizierte Arbeiten erneut publiziert.
Beispiel eines neuen US-Wissenschaftsmagazins - Seed - das den Fortschritt huldigt (versteht sich als ein Organ der "dritten Kultur").
Beispiel eines neuen US-Wissenschaftsmagazins - Seed - das den Fortschritt huldigt (versteht sich als ein Organ der "dritten Kultur").
Ghostwriting in der medizinischen Forschungsliteratur kommt immer noch vor: Derzeit knapp 8% gegenüber gut 11% 1996.
Ghostwriting in der medizinischen Forschungsliteratur kommt immer noch vor: Derzeit knapp 8% gegenüber gut 11% 1996.
Mehrere Artikel zur Frage, warum viele Forscher ihre Daten nicht teilen wollen. Und Beispiele von prepublication data sharing vorab in der Molekularbiologie/Genetik.
Mehrere Artikel zur Frage, warum viele Forscher ihre Daten nicht teilen wollen. Und Beispiele von prepublication data sharing vorab in der Molekularbiologie/Genetik.
Kritische Gedanken zur Rolle der Wissenschaftskommunikation von Universitäten und Forschungsförderungs-Organisationen.
Kritische Gedanken zur Rolle der Wissenschaftskommunikation von Universitäten und Forschungsförderungs-Organisationen.
Gemäss einer Studie finden wissenschaftliche Themen in den deutschsprachigen Medien vermehrt Zuspruch - allerdings nur die Naturwissenschaften.
Gemäss einer Studie finden wissenschaftliche Themen in den deutschsprachigen Medien vermehrt Zuspruch - allerdings nur die Naturwissenschaften.
Zur Nutzung von Blogs und sozialen Netzen in der Wissenschaftskommunikation (das dürfte die Oberflächlichkeit weiter fördern). Und drei Essays zur Bedeutung des Wissenschaftsjournalismus.
Zur Nutzung von Blogs und sozialen Netzen in der Wissenschaftskommunikation (das dürfte die Oberflächlichkeit weiter fördern). Und drei Essays zur Bedeutung des Wissenschaftsjournalismus.
Zur Bedeutung elektronischer Medien für Archivare und der damit verbundenen Forschung.
Zur Bedeutung elektronischer Medien für Archivare und der damit verbundenen Forschung.
Zur Ethik der Autorenschaft bei wissenschaftlichen Artikeln: Konsens ist da, um Umsetzung bemüht sich kaum jemand.
Zur Ethik der Autorenschaft bei wissenschaftlichen Artikeln: Konsens ist da, um Umsetzung bemüht sich kaum jemand.
Abschätzung des Umfangs der fälschung und Verschweigung von Daten in der Wissenschaft (aber die Datenbasis ist recht klein).
Abschätzung des Umfangs der fälschung und Verschweigung von Daten in der Wissenschaft (aber die Datenbasis ist recht klein).
Autoren in Nature-Publikationen müssen künftig ihren Anteil am Paper klar offenlegen.
Autoren in Nature-Publikationen müssen künftig ihren Anteil am Paper klar offenlegen.
Zur Schwierigkeit von Rankings anhand von Publikationen in den Geisteswissenschaften am Beispiel Philosophie. Hier muss man anders messen.
Zur Schwierigkeit von Rankings anhand von Publikationen in den Geisteswissenschaften am Beispiel Philosophie. Hier muss man anders messen.
Zur open access Politik an den NIH: Dort beschäftigte Forscher müssen ihre Papers via PubMed zugänglich machen.
Zur open access Politik an den NIH: Dort beschäftigte Forscher müssen ihre Papers via PubMed zugänglich machen.
Eine Einschätzung der Bedeutung von eBooks (vorab für die Akademische Welt). Lehrbücher werden zunehmend elektronisch produziert.
Eine Einschätzung der Bedeutung von eBooks (vorab für die Akademische Welt). Lehrbücher werden zunehmend elektronisch produziert.
Ein Dossier über Wissenschaftskommunikation, viele Gemeinplätze (eine typische Art, solche Texte für solche Bulletins zu schreiben).
Ein Dossier über Wissenschaftskommunikation, viele Gemeinplätze (eine typische Art, solche Texte für solche Bulletins zu schreiben).
Zwei Artikel: einer zum Niedergang des Wissenschaftsjournalismus (im Gegenzug gibt es immer mehr science blogs). Ein zweiter zur enormen Zunahme elektronischer Daten aus dem Gesundheitsbereich, was Datenbank-Forscher in diesem Bereich…
Zwei Artikel: einer zum Niedergang des Wissenschaftsjournalismus (im Gegenzug gibt es immer mehr science blogs). Ein zweiter zur enormen Zunahme elektronischer Daten aus dem Gesundheitsbereich, was Datenbank-Forscher in diesem Bereich freuen wird (doch das Datenschutz-Problem bleibt).
Hochinteressante Analyse: Die Ânalyse von clickstreams beim Durchgang durch wissenschaftliche eJournals als Mass für die Distanz von Disziplinen.
Hochinteressante Analyse: Die Ânalyse von clickstreams beim Durchgang durch wissenschaftliche eJournals als Mass für die Distanz von Disziplinen.
Zum Aufbau von Sage - einer umfassenden Datenbank medizinischer Informationen aus der Forschung, der Idee von open access folgend.
Zum Aufbau von Sage - einer umfassenden Datenbank medizinischer Informationen aus der Forschung, der Idee von open access folgend.
Eine generelle Beurteilung von open access für die Wissenschaft: wird generell unterstützt.
Eine generelle Beurteilung von open access für die Wissenschaft: wird generell unterstützt.
Stand der Dinge hinsichtlich der Idee, den globalen Verkehr mehr und mehr elektrisch zu betreiben (und damit auch ein riesiges Speichernetz für Strom aufzubauen).
Stand der Dinge hinsichtlich der Idee, den globalen Verkehr mehr und mehr elektrisch zu betreiben (und damit auch ein riesiges Speichernetz für Strom aufzubauen).
Beispiel eines Editors, der sein Journal nicht nur dazu braucht, um seine Arbeit zu publizieren sondern auch noch durch geschickte Zitationspolitik des Citation Index seines Journals raufgebracht hat.
Beispiel eines Editors, der sein Journal nicht nur dazu braucht, um seine Arbeit zu publizieren sondern auch noch durch geschickte Zitationspolitik des Citation Index seines Journals raufgebracht hat.
Hagner zur Bedeutung der Sprache in den Geisteswissenschaften und warum es falsch wäre, auf nur eine Wissenschaftssprache zu setzen.
Hagner zur Bedeutung der Sprache in den Geisteswissenschaften und warum es falsch wäre, auf nur eine Wissenschaftssprache zu setzen.
Ältere Wissenschaftler publizieren mehr als jüngere - soviel zum Jugendwahn in den Wissenschaften.
Ältere Wissenschaftler publizieren mehr als jüngere - soviel zum Jugendwahn in den Wissenschaften.
Wie man mit dem h-Index (misst gleichermassen wie viel jemand publiziert und wie oft er zitiert wird) die Publikationstätigkeit von Forschern ermitteln will (und welche Schwächen dieser Intex hat)
Wie man mit dem h-Index (misst gleichermassen wie viel jemand publiziert und wie oft er zitiert wird) die Publikationstätigkeit von Forschern ermitteln will (und welche Schwächen dieser Intex hat)
Beispiel eines ganz besonders frechen Plagiats: cut and paste. Eine Software identifizierte 75'000 praktisch identische Abstracts auf Medline.
Beispiel eines ganz besonders frechen Plagiats: cut and paste. Eine Software identifizierte 75'000 praktisch identische Abstracts auf Medline.
Positive Korrelation zwischen der Länge eines Papers und seiner Zitieruung (aber nur für Astronomie geprüft - dürfte bei anderen Disziplinen anders sein).
Positive Korrelation zwischen der Länge eines Papers und seiner Zitieruung (aber nur für Astronomie geprüft - dürfte bei anderen Disziplinen anders sein).
Diverse Artikel zur Frage, wie Wissenschaftler mit der Datenflut umgehen sollen: Nutzen von Wikis, Unterhalt der Daten. Und was ganz anderes: abfotografierte Slides an Konferenzen gelten offenbar schon als zitierfähig…
Diverse Artikel zur Frage, wie Wissenschaftler mit der Datenflut umgehen sollen: Nutzen von Wikis, Unterhalt der Daten. Und was ganz anderes: abfotografierte Slides an Konferenzen gelten offenbar schon als zitierfähig ("Physik-Papparazzi").
Das Problem der niedrigqualifizierten Arbeitskräfte: es gibt weniger Jobs (und nicht weniger Lohn), obgleich zunehmend Mindestlöhne eingeführt wurden. Dies stützt die These, das Mindeslöhne die Arbeitslosigkeit für Minderqualifizierte erhöhen.
Das Problem der niedrigqualifizierten Arbeitskräfte: es gibt weniger Jobs (und nicht weniger Lohn), obgleich zunehmend Mindestlöhne eingeführt wurden. Dies stützt die These, das Mindeslöhne die Arbeitslosigkeit für Minderqualifizierte erhöhen.
Höhere Verfügbarkeit von Online-Publikationen vermindert die Zahl der zitierten Artikel (primär hochzitierte Publikationen kommen zum Zug). Zudem werden ältere Artikel immer weniger zitiert: d.h. Blickeinengung und Gedächtnisverlust.
Höhere Verfügbarkeit von Online-Publikationen vermindert die Zahl der zitierten Artikel (primär hochzitierte Publikationen kommen zum Zug). Zudem werden ältere Artikel immer weniger zitiert: d.h. Blickeinengung und Gedächtnisverlust.
Ein neues geisteswissenschaftliches Magazin in Deutschland: Recherche (derzeit noch kein wirkliches Debatte-Magazin).
Ein neues geisteswissenschaftliches Magazin in Deutschland: Recherche (derzeit noch kein wirkliches Debatte-Magazin).
Zur Kostenstruktur der Public Library of Science.
Zur Kostenstruktur der Public Library of Science.
Zur grossen Zunahme der Bildgebung in der Mikrobiologie und wie das die Kommunikation der Resultate verändert.
Zur grossen Zunahme der Bildgebung in der Mikrobiologie und wie das die Kommunikation der Resultate verändert.
Chinesen haben ein Problem bei Zitationsanalysen: zu viele gleiche Namen!
Chinesen haben ein Problem bei Zitationsanalysen: zu viele gleiche Namen!
Neue Methoden suchen nach Duplikat-Publikationen von Wissenschaftlern. Grössenordnung 5-10% aller Paper.
Neue Methoden suchen nach Duplikat-Publikationen von Wissenschaftlern. Grössenordnung 5-10% aller Paper.
Neue Software für das Ranking Zeitschriften anhand von Zitationen: klassischer Impact Factor wird konkurrenziert.
Neue Software für das Ranking Zeitschriften anhand von Zitationen: klassischer Impact Factor wird konkurrenziert.
Rechtliche Anmerkungen zu Plagiaten in universitären Arbeiten.
Rechtliche Anmerkungen zu Plagiaten in universitären Arbeiten.
Wie die Forscher mit Wikipedia umgehen (zitierbar oder nicht?).
Wie die Forscher mit Wikipedia umgehen (zitierbar oder nicht?).
Ein Zwischenbericht zum Stand des E-Learning an der Universität Zürich.
Ein Zwischenbericht zum Stand des E-Learning an der Universität Zürich.
Einige grundlegende Gedanken zu open access und dem Unterschied zu free access.
Einige grundlegende Gedanken zu open access und dem Unterschied zu free access.
Zur Kontroverse um die kalte Fusion: offenbar wurden hierbei keine Manipulationen von Daten vorgenommen.
Zur Kontroverse um die kalte Fusion: offenbar wurden hierbei keine Manipulationen von Daten vorgenommen.
Wie sich die Universität Zürich gegen die Zunahme an Plagiaten (durch Studenten) wehren will.
Wie sich die Universität Zürich gegen die Zunahme an Plagiaten (durch Studenten) wehren will.
Eine Übersicht zu den Strategien gegen Fehlverhalten von Wissenschaftlern (vorab Datenfälschung). Und auch eine Übersicht, was bekannte Fälscher heute so tun (Schön, Hwang etc.).
Eine Übersicht zu den Strategien gegen Fehlverhalten von Wissenschaftlern (vorab Datenfälschung). Und auch eine Übersicht, was bekannte Fälscher heute so tun (Schön, Hwang etc.).
Statistische Beurteilung von verschiedenen Massen für die Qualität von Publikationen.
Statistische Beurteilung von verschiedenen Massen für die Qualität von Publikationen.
Nebst Open Access betreffend Publikationen werden nun immer mehr auch die Daten selbst öffentlich zugänglich gemacht – an sich ein guter Prozess, doch wie will man da die Übersicht behalten?
Nebst Open Access betreffend Publikationen werden nun immer mehr auch die Daten selbst öffentlich zugänglich gemacht – an sich ein guter Prozess, doch wie will man da die Übersicht behalten?
Abschluss des World Knowledge Dialogue Symposiums (das es nicht braucht). Interessant: die Idee eines Europäischen Santa Fe Institutes (ja, das braucht es).
Abschluss des World Knowledge Dialogue Symposiums (das es nicht braucht). Interessant: die Idee eines Europäischen Santa Fe Institutes (ja, das braucht es).
Es ist gar nicht so einfach, ein Resultat zu replizieren (abgesehen davon, dass wohl nur wenige Resultate wirklich repliziert werden).
Es ist gar nicht so einfach, ein Resultat zu replizieren (abgesehen davon, dass wohl nur wenige Resultate wirklich repliziert werden).
Wie open access die Publikationstätigkeit beeinflusst.
Wie open access die Publikationstätigkeit beeinflusst.
Zur Frage des Zugangs zum quantitativ immer stärker zunehmenden Wissen der Wissenschaft. Welche Rolle könnte hier z.B. ein scientific data mining haben?
Zur Frage des Zugangs zum quantitativ immer stärker zunehmenden Wissen der Wissenschaft. Welche Rolle könnte hier z.B. ein scientific data mining haben?
Die Entdeckung von Potenzgesetzen ist ein Fallbeispiel dafür, wie alte Ergebnisse in einem neuen Gewand wieder erscheinen - als Folge des Drucks, immer mehr publizieren zu müssen.
Die Entdeckung von Potenzgesetzen ist ein Fallbeispiel dafür, wie alte Ergebnisse in einem neuen Gewand wieder erscheinen - als Folge des Drucks, immer mehr publizieren zu müssen.
Ein neuer Vorschlag für die Bewertung der Qualität von wissenschaftlichen Zeitschriften basierend auf dem Ranking-Algorithmus von Google.
Ein neuer Vorschlag für die Bewertung der Qualität von wissenschaftlichen Zeitschriften basierend auf dem Ranking-Algorithmus von Google.
Wie die Zeitschriften gefälschte Papers besser entdecken wollen - z.B. solche mit manipulierten Bildern.
Wie die Zeitschriften gefälschte Papers besser entdecken wollen - z.B. solche mit manipulierten Bildern.
Zum Problem des Peer Review.
Zum Problem des Peer Review.
Google startet eine Suchmaschine für Papers. Dazu ein zweiter Artikel über die Bedeutung des Internet für die Wissenschaftskommunikation.
Google startet eine Suchmaschine für Papers. Dazu ein zweiter Artikel über die Bedeutung des Internet für die Wissenschaftskommunikation.
Eine statistische Untersuchung zeigt, dass eine Wahrscheinlichkeit von über 50% besteht, dass eine beliebige Studie falsche Resultate liefert - vorab wegen zu geringer Samplegrösse, schlechtem Studiendesign, Befangenheit der Wissenschaftler und…
Eine statistische Untersuchung zeigt, dass eine Wahrscheinlichkeit von über 50% besteht, dass eine beliebige Studie falsche Resultate liefert - vorab wegen zu geringer Samplegrösse, schlechtem Studiendesign, Befangenheit der Wissenschaftler und selektive Auswertung der Resultate.
Übersicht zu einer Studie über Plagiate, Fälschungen und andere Verfehlungen von Wissenschaftlern. Dieses Verhalten findet sich stärker bei Leuten, die schon lange dabei sind und nicht bei den Einsteigern.
Übersicht zu einer Studie über Plagiate, Fälschungen und andere Verfehlungen von Wissenschaftlern. Dieses Verhalten findet sich stärker bei Leuten, die schon lange dabei sind und nicht bei den Einsteigern.
Hinweis auf ein neues Wissenschaftsportal der EU.
Hinweis auf ein neues Wissenschaftsportal der EU.
Zum Problem des Plagiats und einige Zahlen, wie oft das vorkommt (20% gemäss einer Studie).
Zum Problem des Plagiats und einige Zahlen, wie oft das vorkommt (20% gemäss einer Studie).
Über die Strafbarkeit des Wissenschaftsbetrugs.
Über die Strafbarkeit des Wissenschaftsbetrugs.
Zum Thema open access im Bereich Medizin sicher hier ein besonderes Problem zumal die Zahl der Zeitschriften hier gross ist und sich etwa das Problem der Duplikation bereits bekannter Erkenntnisse…
Zum Thema open access im Bereich Medizin sicher hier ein besonderes Problem zumal die Zahl der Zeitschriften hier gross ist und sich etwa das Problem der Duplikation bereits bekannter Erkenntnisse im Bereich klinischer Forschung stellt.
Warum manche wissenschaftliche Daten nie publiziert werden - vorab solche nicht, welche negative oder unerwünschte Resultate zeigen.
Warum manche wissenschaftliche Daten nie publiziert werden - vorab solche nicht, welche negative oder unerwünschte Resultate zeigen.
Grundsätzliche Überlegungen von Fischer über die Vermittlung von Wissenschaft.
Grundsätzliche Überlegungen von Fischer über die Vermittlung von Wissenschaft.
Eine Geschäftsidee in der Wissensgesellschaft: GetAbstract.
Eine Geschäftsidee in der Wissensgesellschaft: GetAbstract.
Eine Verschiebung im Wissenschaftsjournalismus: hin zu einem Nutzwertjournalismus, wo der Nutzen im Vordergrund steht und der Einfluss der PR steigt.
Eine Verschiebung im Wissenschaftsjournalismus: hin zu einem Nutzwertjournalismus, wo der Nutzen im Vordergrund steht und der Einfluss der PR steigt.
Zwei Zeitschriften in den USA, welche die life sciences in eher lockerer Form in eine publizistische Form giessen.
Zwei Zeitschriften in den USA, welche die life sciences in eher lockerer Form in eine publizistische Form giessen.
Kritische Bemerkungen zur Rolle des Impact Factors für die Bewertung von Forschung.
Kritische Bemerkungen zur Rolle des Impact Factors für die Bewertung von Forschung.
Zum Problem, dass immer weniger Zeitschriften zugänglich sind - einfach deshalb, weil es zu viele davon gibt.
Zum Problem, dass immer weniger Zeitschriften zugänglich sind - einfach deshalb, weil es zu viele davon gibt.
Überlegungen zum Wissenstransfer Wissenschaft zu Politik.
Überlegungen zum Wissenstransfer Wissenschaft zu Politik.
Kritische Bemerkungen zum Review-System und dessen abnehmende Qualität.
Kritische Bemerkungen zum Review-System und dessen abnehmende Qualität.
Publikationseinschränkungen nach 09/11: Gewisse Resultate, die als Gefährdung der nationalen Sicherheit aufgefasst werden, sollen nicht mehr publiziert werden.
Publikationseinschränkungen nach 09/11: Gewisse Resultate, die als Gefährdung der nationalen Sicherheit aufgefasst werden, sollen nicht mehr publiziert werden.
Die Verführung des Bildes in der Wissenschaftskommunikation - dieses Problem wird zweifellos zunehmen, zumal die dafür nötige Software immer einfacher zu bedienen wird.
Die Verführung des Bildes in der Wissenschaftskommunikation - dieses Problem wird zweifellos zunehmen, zumal die dafür nötige Software immer einfacher zu bedienen wird.
Zur Bedeutung von Metaphern in wissenschaftlichen Texten.
Zur Bedeutung von Metaphern in wissenschaftlichen Texten.
Zur Problematik, wie Journals ihre Beiträge aussuchen. Ich sollte unbedingt mal meine These prüfen, wie sich Modetrends in den grossen Journals (Science, Nature) durchschlagen.
Zur Problematik, wie Journals ihre Beiträge aussuchen. Ich sollte unbedingt mal meine These prüfen, wie sich Modetrends in den grossen Journals (Science, Nature) durchschlagen.
Hinweis auf eine neue deutsche Suchmaschine für Wissenschaft der Universität Hannover.
Hinweis auf eine neue deutsche Suchmaschine für Wissenschaft der Universität Hannover.
Zur wachsenden Bedeutung von do-it-yourself-Zeitschriften und Dokumentenservern, wobei das Problem der Urheberrechte mit den Wissenschaftsverlagen gelöst werden muss.
Zur wachsenden Bedeutung von do-it-yourself-Zeitschriften und Dokumentenservern, wobei das Problem der Urheberrechte mit den Wissenschaftsverlagen gelöst werden muss.
Zur Problematik der Beeinflussung wissenschaftlicher Papers durch finanzielle Bindungen der Forscher.
Zur Problematik der Beeinflussung wissenschaftlicher Papers durch finanzielle Bindungen der Forscher.
Eine neuartike interaktive Fachzeitschrift, bei welcher das peer review mit einer öffentlichen Diskussion verbunden wird.
Eine neuartike interaktive Fachzeitschrift, bei welcher das peer review mit einer öffentlichen Diskussion verbunden wird.
Man sollte das Peer-Review öffnen - insbesondere sollte man die Namen der Autoren verdecken und jene der Gutachter offen legen.
Man sollte das Peer-Review öffnen - insbesondere sollte man die Namen der Autoren verdecken und jene der Gutachter offen legen.
Ein Projekt: junge Forscher beraten Politiker im Parlament und sollen dadurch lernen, wie man Wissenschaft in einem politischen Kontext wirksam präsentiert.
Ein Projekt: junge Forscher beraten Politiker im Parlament und sollen dadurch lernen, wie man Wissenschaft in einem politischen Kontext wirksam präsentiert.
Möglichkeiten und Grenzen des Impact Factors für die Beurteilung von Wissenschaft. Dazu ein Porträt des ISI.
Möglichkeiten und Grenzen des Impact Factors für die Beurteilung von Wissenschaft. Dazu ein Porträt des ISI.
Einige Bemerkungen zur Zukunft der grossen wissenschaftlichen Bibliotheken.
Einige Bemerkungen zur Zukunft der grossen wissenschaftlichen Bibliotheken.
Zu den Mängeln des peer review.
Zu den Mängeln des peer review.
Mittelstrass philosophiert über die Verständigungsprobleme der Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft.
Mittelstrass philosophiert über die Verständigungsprobleme der Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft.
Zur Frage, wie das sematic web die Forschungskommunikation beeinflussen wird.
Zur Frage, wie das sematic web die Forschungskommunikation beeinflussen wird.
Eine grosse Wissenschaftsdatenbank geht online: die französische Literaturdatenbank Pascal.
Eine grosse Wissenschaftsdatenbank geht online: die französische Literaturdatenbank Pascal.
In den USA wurde mit „lingua franca“ ein Boulevardblatt für die Geisteswissenschaften lanciert.
In den USA wurde mit „lingua franca“ ein Boulevardblatt für die Geisteswissenschaften lanciert.
Wie die amerikanischen Astronomen den Europäern zeigen, wie man Astronomie öffentlich verkauft.
Wie die amerikanischen Astronomen den Europäern zeigen, wie man Astronomie öffentlich verkauft.
Zur Geschichte der Enzyklopädien und auch einige Bemerkungen zu Yahoo als digitale Enzyklopädie (heute ist das ja von Wikipedia abgelöst worden).
Zur Geschichte der Enzyklopädien und auch einige Bemerkungen zu Yahoo als digitale Enzyklopädie (heute ist das ja von Wikipedia abgelöst worden).
Zur Herausforderung, eine gute Datenbank für wissenschaftliche Experimente zu kreieren.
Zur Herausforderung, eine gute Datenbank für wissenschaftliche Experimente zu kreieren.
Bericht über eine Tagung über Transdisziplinarität und was das bedeuten kann.
Bericht über eine Tagung über Transdisziplinarität und was das bedeuten kann.
Die Genfer Jeantet-Stiftung fördert auch Projekte für die Kommunikation und Popularisierung von Wissenschaft.
Die Genfer Jeantet-Stiftung fördert auch Projekte für die Kommunikation und Popularisierung von Wissenschaft.
Wie genau definiert man eigentlich misconduct in science. Hier eine Reihe von Aspekte, die das ausmachen können.
Wie genau definiert man eigentlich misconduct in science. Hier eine Reihe von Aspekte, die das ausmachen können.
Eine neue, interessante deutsche Wissenschafts-Zeitschrift: Gegenworte.
Eine neue, interessante deutsche Wissenschafts-Zeitschrift: Gegenworte.
Die wachsenden Probleme der Universitätsbibliotheken mit den Kosten für die Zeitschriften. Längerfristig wird es immer mehr elektronische Zeitschriften geben, die ganz auf eine Druckversion verzichten.
Die wachsenden Probleme der Universitätsbibliotheken mit den Kosten für die Zeitschriften. Längerfristig wird es immer mehr elektronische Zeitschriften geben, die ganz auf eine Druckversion verzichten.
Zur Frage nach der Zukunft der Bibliothek im digitalen Zeitalter und was das für das Berufsbild des Bibliothekars bedeutet.
Zur Frage nach der Zukunft der Bibliothek im digitalen Zeitalter und was das für das Berufsbild des Bibliothekars bedeutet.
Die Bibliotheken der Universitäten haben immer mehr Probleme, weil die Zeitschriften zu teuer werden.
Die Bibliotheken der Universitäten haben immer mehr Probleme, weil die Zeitschriften zu teuer werden.
Zur Diskussion über Fehlverhalten in den Wissenschaften.
Zur Diskussion über Fehlverhalten in den Wissenschaften.
Zum Problem der ständig teurer werdenden Fachzeitschriften. Forscher werden deshalb selbst zu verlegern.
Zum Problem der ständig teurer werdenden Fachzeitschriften. Forscher werden deshalb selbst zu verlegern.
Über die Bedeutung des Internets für die Verbreitung wissenschaftlicher Arbeiten.
Über die Bedeutung des Internets für die Verbreitung wissenschaftlicher Arbeiten.
Die Forscher sollen vermehrt ihre Tätigkeit der Öffentlichkeit erklären.
Die Forscher sollen vermehrt ihre Tätigkeit der Öffentlichkeit erklären.
Warum die Forderung der Wissenschaftler, die Medien sollten präziser über Wissenschaft berichten, unrealistisch sei. Dazu eine Übersicht über Initiativen zur Förderung der Popularisierung von Wissenschaft.
Warum die Forderung der Wissenschaftler, die Medien sollten präziser über Wissenschaft berichten, unrealistisch sei. Dazu eine Übersicht über Initiativen zur Förderung der Popularisierung von Wissenschaft.
Interview mit Novotny - unter anderem über Technikfolgenabschätzung.
Interview mit Novotny - unter anderem über Technikfolgenabschätzung.
Wie die Genschutz-Initiative das Verhältnis der Forscher zur Öffentlichkeit verändert haben soll (man müsste aber einmal prüfen, inwiefern sich das auswirkt - ich denke vorab durch die Integration von PR-Leuten…
Wie die Genschutz-Initiative das Verhältnis der Forscher zur Öffentlichkeit verändert haben soll (man müsste aber einmal prüfen, inwiefern sich das auswirkt - ich denke vorab durch die Integration von PR-Leuten und nicht durch das geänderte