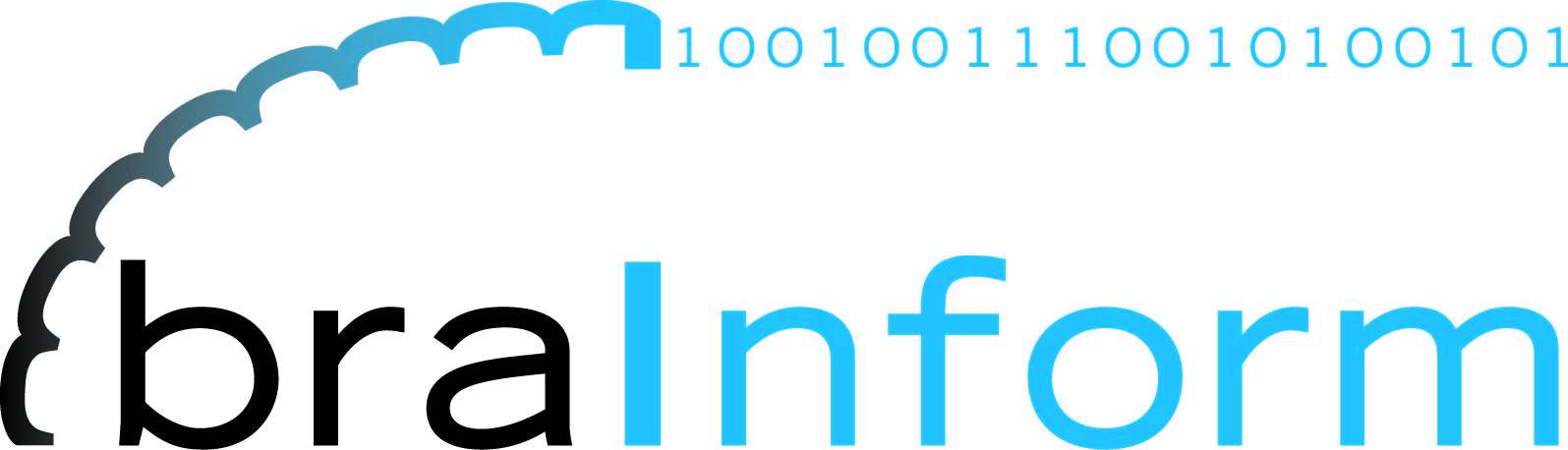Beispiel eines ideologisierten Geschichtswissenschaftlers: Bernhard Schär
Beispiel eines ideologisierten Geschichtswissenschaftlers: Bernhard Schär
Wie sich die US-Hochschulen zum Ziel von Trumps Rachefeldzug gemacht haben.
Wie sich die US-Hochschulen zum Ziel von Trumps Rachefeldzug gemacht haben.
Wie die verschärften Visa-Regeln die britischen Universitäten in den Kollaps führt.
Wie die verschärften Visa-Regeln die britischen Universitäten in den Kollaps führt.
Der Boykott westschweizer Unis einer israelischen Hochschule ist ein Tiefpunkt der Universitätskultur.
Der Boykott westschweizer Unis einer israelischen Hochschule ist ein Tiefpunkt der Universitätskultur.
Immer mehr Ärzte arbeiten Teilzeit, so dass sich das enorme Investment in deren Ausbildung nicht mehr lohnt - was man dagegen tun sollte.
Immer mehr Ärzte arbeiten Teilzeit, so dass sich das enorme Investment in deren Ausbildung nicht mehr lohnt - was man dagegen tun sollte.
Was an den US-Hochschulen fragwürdig ist: Elite-Denken und Geschäftsmodell
Was an den US-Hochschulen fragwürdig ist: Elite-Denken und Geschäftsmodell
Ausländische Studierende brechen ihr Studium deutlich häufiger ab, was implizit den tieferen Wert der ausländischen Matur aufzeigt.
Ausländische Studierende brechen ihr Studium deutlich häufiger ab, was implizit den tieferen Wert der ausländischen Matur aufzeigt.
Die steigenden Kosten an den Hochschulen sind auch eine Folge politischer Entscheide, die zu einer vermehrten Bürokratisierung der Hochschulen führen.
Die steigenden Kosten an den Hochschulen sind auch eine Folge politischer Entscheide, die zu einer vermehrten Bürokratisierung der Hochschulen führen.
Zum Selbstwiderspruch, dem das Plädoyer gegen Funktionalisierung und Instrumentalisierung der Wissenschaft inneliegt.
Zum Selbstwiderspruch, dem das Plädoyer gegen Funktionalisierung und Instrumentalisierung der Wissenschaft inneliegt.
Die Kosten pro Studierende steigen an allen Zürcher Hochschulen an.
Die Kosten pro Studierende steigen an allen Zürcher Hochschulen an.
Unklare Zahle, wie viel ein Medizinstudiem wirklich kostet: Der Betrag ist nur deshalb so hoch, weil man die Forschung dazurechnet.
Unklare Zahle, wie viel ein Medizinstudiem wirklich kostet: Der Betrag ist nur deshalb so hoch, weil man die Forschung dazurechnet.
Wie der Campus (am Beispiel USA) zu einem Seismograf des gesellschaftlichen Wandels wurde.
Wie der Campus (am Beispiel USA) zu einem Seismograf des gesellschaftlichen Wandels wurde.
Die zwei komplett verschiedenen Sichten auf die Proteste an der Columbia-Universität (und anderswo)
Die zwei komplett verschiedenen Sichten auf die Proteste an der Columbia-Universität (und anderswo)
Wie sich die Freiheit des Denkens aus den amerikanischen Elite-Hochschulen verabschiedet - auch eine Folge des Finanzierungsmodells.
Wie sich die Freiheit des Denkens aus den amerikanischen Elite-Hochschulen verabschiedet - auch eine Folge des Finanzierungsmodells.
Hochschulen wehren sich dagegen, dass die Bildungsausgaben weniger stark steigen als sie sich wünschen
Hochschulen wehren sich dagegen, dass die Bildungsausgaben weniger stark steigen als sie sich wünschen
Im britischen Hochschulewesen gibt es nun ein Regierungsbeauftragter, der gegen die cancel culture an den Hochschulen antreten soll.
Im britischen Hochschulewesen gibt es nun ein Regierungsbeauftragter, der gegen die cancel culture an den Hochschulen antreten soll.
Symbolpolitik in den Hochschulen am Beispiel Berlin: die wahren probleme (marode Infrastruktur etc.) werden nicht angesprochen, stattdessen kämpft man gegen "Rechts".
Symbolpolitik in den Hochschulen am Beispiel Berlin: die wahren probleme (marode Infrastruktur etc.) werden nicht angesprochen, stattdessen kämpft man gegen "Rechts".
Die US-Spitzenuniversitäten diskutieren deshab über Rasse und Identität, weil sie nicht über soziale Ungleichheit sprechen wollen.
Die US-Spitzenuniversitäten diskutieren deshab über Rasse und Identität, weil sie nicht über soziale Ungleichheit sprechen wollen.
Eine umfassende Übersicht, wann welche Studierenden im Bildungspfad "abspringen" (also ins nichtakademische Berufsleben wechseln).
Eine umfassende Übersicht, wann welche Studierenden im Bildungspfad "abspringen" (also ins nichtakademische Berufsleben wechseln).
Das Problem der Geschichte ist nicht, dass es immer weniger studierende gibt (ans ich gut) - sondern, dass sich die Geschichtsprofessoren in ihren Spezialthemen verlieren und keinen Beitrag mehr leisten…
Das Problem der Geschichte ist nicht, dass es immer weniger studierende gibt (ans ich gut) - sondern, dass sich die Geschichtsprofessoren in ihren Spezialthemen verlieren und keinen Beitrag mehr leisten zu gesellschaftlichen Debatten.
Das Interesse der Studierenden an den Geisteswissenschaften sinkt (die Zahlen sind aber weiterhin hoch)
Das Interesse der Studierenden an den Geisteswissenschaften sinkt (die Zahlen sind aber weiterhin hoch)
Wie die Woke-Heuchler an US-Eliteuniversitäten Menschen zerstören.
Wie die Woke-Heuchler an US-Eliteuniversitäten Menschen zerstören.
Auch in der Schweiz werden die Geisteswissenschaften vermehrt ideologisiert.
Auch in der Schweiz werden die Geisteswissenschaften vermehrt ideologisiert.
Die Studierendenzahlen in den Geistes- und Sozialwissenschaften stagnieren.
Die Studierendenzahlen in den Geistes- und Sozialwissenschaften stagnieren.
Ein erhellendes Interview mit Elisabeth Bronfen zum Wandel der Hochschulen.
Ein erhellendes Interview mit Elisabeth Bronfen zum Wandel der Hochschulen.
Die affirmative action steht in den USA vor dem Ende
Die affirmative action steht in den USA vor dem Ende
Warum man sich als Geisteswissenschaftler realistischerweise auf eine art prekäre Existenz einstellen sollte.
Warum man sich als Geisteswissenschaftler realistischerweise auf eine art prekäre Existenz einstellen sollte.
Die Cancel Culture begann in den USA in den 1950er Jahre von rechter Seite.
Die Cancel Culture begann in den USA in den 1950er Jahre von rechter Seite.
Die Hochschulen müssen stärker strategische Erwägungen einbeziehen, wen sie da eigentlich ausbilden - das Beispiel der iranischen Drohnen-Ingenieure.
Die Hochschulen müssen stärker strategische Erwägungen einbeziehen, wen sie da eigentlich ausbilden - das Beispiel der iranischen Drohnen-Ingenieure.
Wie der Kanton Zürich mit Bürokratie und Kontrollwahn das Stipendienwesen an die Wand gefahren hat.
Wie der Kanton Zürich mit Bürokratie und Kontrollwahn das Stipendienwesen an die Wand gefahren hat.
Nun schliessen sogar die analytischen Philosophen Leute aus, wenn sie unsinnige Appelle unterschrieben haben... (früher machte man einen Witz darüber).
Nun schliessen sogar die analytischen Philosophen Leute aus, wenn sie unsinnige Appelle unterschrieben haben... (früher machte man einen Witz darüber).
Rückblick auf den Begründer des Humbold-Ideals.
Rückblick auf den Begründer des Humbold-Ideals.
Die Universitäten verkommen immer mehr zu ideologisierten Meinungsfabriken - kritisches Denken muss man anderswo pflegen.
Die Universitäten verkommen immer mehr zu ideologisierten Meinungsfabriken - kritisches Denken muss man anderswo pflegen.
Zahlen über Kosten und Nutzen verschiedener Studienrichtungen für die Gesellschaft.
Zahlen über Kosten und Nutzen verschiedener Studienrichtungen für die Gesellschaft.
Ein mit den Hochschulen verknüpftes Migrationsgeschäft: Hochschulen verdienen an ausländischen Studenten, dies gelangen mit gefälschten Visas in die europäischen Staaten, z.B. Lettland.
Ein mit den Hochschulen verknüpftes Migrationsgeschäft: Hochschulen verdienen an ausländischen Studenten, dies gelangen mit gefälschten Visas in die europäischen Staaten, z.B. Lettland.
Forscher die betrügen werden nur selten geahndet.
Forscher die betrügen werden nur selten geahndet.
Ein Studium der Geisteswissenschaften bringt ökonomisch gesehen den wenigsten etwas. Die Geisteswissenschaften entwickeln sich in der Schweiz zum moralischen Vergnügungspark jener, die auf ihr Erbe warten.
Ein Studium der Geisteswissenschaften bringt ökonomisch gesehen den wenigsten etwas. Die Geisteswissenschaften entwickeln sich in der Schweiz zum moralischen Vergnügungspark jener, die auf ihr Erbe warten.
Nur Schwarze dürfen akademisch über Schwarze schreiben - in diese Richtung geht es im US-Hochschulwesen.
Nur Schwarze dürfen akademisch über Schwarze schreiben - in diese Richtung geht es im US-Hochschulwesen.
Wie die Wahrheit als Orientierung an den Hochschulen immer mehr unter Druck gerät - Vorwürfe von Peterson
Wie die Wahrheit als Orientierung an den Hochschulen immer mehr unter Druck gerät - Vorwürfe von Peterson
In Austin soll eine Universität gegen die woke-Gleichschaltung entstehen.
In Austin soll eine Universität gegen die woke-Gleichschaltung entstehen.
China verfolgte in jüngster Zeit eine ähnliche Strategie die die USA: Studierende aus aller Welt anzulocken. Doch das strenge Corona-Regime und die Abkapselung Chinas macht diese Anstrengungen zunichte.
China verfolgte in jüngster Zeit eine ähnliche Strategie die die USA: Studierende aus aller Welt anzulocken. Doch das strenge Corona-Regime und die Abkapselung Chinas macht diese Anstrengungen zunichte.
Wie am an Schweizer Universitäten Professoren künftig führen will.
Wie am an Schweizer Universitäten Professoren künftig führen will.
Ein Fallbeispiel, wie China Druck auf Angehörige Schweizer Hochschulen macht.
Ein Fallbeispiel, wie China Druck auf Angehörige Schweizer Hochschulen macht.
Warum Triggerwarnungen bei Literatur-Klassikern im Hochschulstudium Unsinn ist (was sollen die Leute denn lernen?)
Warum Triggerwarnungen bei Literatur-Klassikern im Hochschulstudium Unsinn ist (was sollen die Leute denn lernen?)
Zum wachsenden Konformismus an den Hochschulen.
Zum wachsenden Konformismus an den Hochschulen.
Die Universitäten sind nicht mehr die Kaderschmieden der Nation, die Fachhochschulen sind das.
Die Universitäten sind nicht mehr die Kaderschmieden der Nation, die Fachhochschulen sind das.
Das Business-Modell der Elite-Schulen am Beispiel Oxford und wie es unter Druck gekommen ist (und Bemerkung, dass die staatlichen Garantien für Studentenjkredite nichts anderes sind als eine Steuer - aber…
Das Business-Modell der Elite-Schulen am Beispiel Oxford und wie es unter Druck gekommen ist (und Bemerkung, dass die staatlichen Garantien für Studentenjkredite nichts anderes sind als eine Steuer - aber immerhin sozialer, denn die Erfolgreichen müssen zurückzahlen).
Das angelsächsische Hochschulmodell führt zu einer zersplitterten, selbstreferenziellen Sozialwissenschaft.
Das angelsächsische Hochschulmodell führt zu einer zersplitterten, selbstreferenziellen Sozialwissenschaft.
Das Geschäftsmodell der US-Elite-Unis zerbricht aktuell gerade, weil die Studierenden aus dem Ausland, welche die hohen Gebühren zahlen, nicht mehr kommen (dürfen).
Das Geschäftsmodell der US-Elite-Unis zerbricht aktuell gerade, weil die Studierenden aus dem Ausland, welche die hohen Gebühren zahlen, nicht mehr kommen (dürfen).
Wie der Moralismus in den Hochschulen die freie Kritik zunehmend verdrängt.
Wie der Moralismus in den Hochschulen die freie Kritik zunehmend verdrängt.
In Russland rächt sich nun die langanhaltende Zerstörung des wissenschaftlichen Systems durch die Putin-Korruption (Fake-Wissenschaftler geraten mit guten Beziehungen an Spitzenstellungen): viele Scharlatane äussern sich nun zu Corona.
In Russland rächt sich nun die langanhaltende Zerstörung des wissenschaftlichen Systems durch die Putin-Korruption (Fake-Wissenschaftler geraten mit guten Beziehungen an Spitzenstellungen): viele Scharlatane äussern sich nun zu Corona.
Warum die Verpolitisierung und der Aktivismus in der Wissenschaft falsch ist - Moral verdrängt Erkenntnis.
Warum die Verpolitisierung und der Aktivismus in der Wissenschaft falsch ist - Moral verdrängt Erkenntnis.
Wie die Dogmatiker der "Studies" Fächer das freie Denken an den Universitäten zerstören.
Wie die Dogmatiker der "Studies" Fächer das freie Denken an den Universitäten zerstören.
In den US-Geisteswissenschaften zählt Leistung immer weniger, man muss Diversitätsmässig gut drauf sein, damit man Jobs bekommt.
In den US-Geisteswissenschaften zählt Leistung immer weniger, man muss Diversitätsmässig gut drauf sein, damit man Jobs bekommt.
Übersicht über die Schweizer Hochschul-Landschaft.
Übersicht über die Schweizer Hochschul-Landschaft.
Die positiven Seiten der Antidiskriminierungspolitik an den Hochschulen.
Die positiven Seiten der Antidiskriminierungspolitik an den Hochschulen.
Ein Bericht aus Harvard, wo die Wahrheit zugunsten der Diversität auf der Strecke bleibt.
Ein Bericht aus Harvard, wo die Wahrheit zugunsten der Diversität auf der Strecke bleibt.
Zum Grad der Ideologisierung der Forschung von allen, was mit Transgender zu tun hat.
Zum Grad der Ideologisierung der Forschung von allen, was mit Transgender zu tun hat.
Stand des Kulturkampfes in den angelsächsischen Universitäten. Der linken Schein-Diversität wird vermehrt der Kampf angesagt.
Stand des Kulturkampfes in den angelsächsischen Universitäten. Der linken Schein-Diversität wird vermehrt der Kampf angesagt.
Wieder einmal ein Plädoyer für den Nutzen der Geisteswissenschaften.
Wieder einmal ein Plädoyer für den Nutzen der Geisteswissenschaften.
Bei den Fachhochschulen wächst vor allem die Administration.
Bei den Fachhochschulen wächst vor allem die Administration.
Die Universitäten entwickeln sich zu Orten der Selbstoptimierung.
Die Universitäten entwickeln sich zu Orten der Selbstoptimierung.
Einer der wiederkehrenden Berichte zum political correctness Intoleranzen an US Hochschulen.
Einer der wiederkehrenden Berichte zum political correctness Intoleranzen an US Hochschulen.
Zahlen zum Schweizer Hochschulwesen: immer mehr Doktoranden und Post-Docs, die dann keine Stelle finden.
Zahlen zum Schweizer Hochschulwesen: immer mehr Doktoranden und Post-Docs, die dann keine Stelle finden.
Zu den sogenannten Mikro-Aggressionen, welche man an US-Hochschulen vermeiden sollte.
Zu den sogenannten Mikro-Aggressionen, welche man an US-Hochschulen vermeiden sollte.
Zum Spannungsfeld zwischen dem humboldschen Bildungsideal und der Digitalisierung.
Zum Spannungsfeld zwischen dem humboldschen Bildungsideal und der Digitalisierung.
Bericht über die bizarren Auswüchse der political correctness an den US-Hochschulen.
Bericht über die bizarren Auswüchse der political correctness an den US-Hochschulen.
Ein Plädoyer für Bildung statt Ausbildung an den Hochschulen.
Ein Plädoyer für Bildung statt Ausbildung an den Hochschulen.
Überblick, wie viel man in den USA für den Besuch einer Universität zahlen muss.
Überblick, wie viel man in den USA für den Besuch einer Universität zahlen muss.
Langsam wächst der Widerstand gegen die Akademisierung von Bildungsgängen.
Langsam wächst der Widerstand gegen die Akademisierung von Bildungsgängen.
Zur Bedeutung der Schnittstell-Jobs zwischen Forschung und Management für die Hochschulen ("Third Space").
Zur Bedeutung der Schnittstell-Jobs zwischen Forschung und Management für die Hochschulen ("Third Space").
Eine Studie zeigt, dass die bosnischen Studierenden oft aus Dünkel und dem Glauben, sie seien besonders wichtig, sich weigern, überhaupt erst Arbeit zu suchen. Hinweis darauf, was eine Fehlentwicklung ist…
Eine Studie zeigt, dass die bosnischen Studierenden oft aus Dünkel und dem Glauben, sie seien besonders wichtig, sich weigern, überhaupt erst Arbeit zu suchen. Hinweis darauf, was eine Fehlentwicklung ist im Hochschulbereich (in Kombination mit einem Staat mit sozialistischer Geschichte).
Warum es auch innerhalb der EU unsinnig ist, überall den freien Zugang zu den Universitäten zu gewähren.
Warum es auch innerhalb der EU unsinnig ist, überall den freien Zugang zu den Universitäten zu gewähren.
Das Bundesgericht verfügt einen Rechtsanspruch von Ausländern auf einen Schweizer Studienplatz - Mobilität sei wichtiger als Qualität (welch ein Irrtum).
Das Bundesgericht verfügt einen Rechtsanspruch von Ausländern auf einen Schweizer Studienplatz - Mobilität sei wichtiger als Qualität (welch ein Irrtum).
Eine besondere Form von Studienförderung: Investoren unterstützen Studierende und erhalten später dann einen Teil von deren Lohn (sofern sie genug verdienen).
Eine besondere Form von Studienförderung: Investoren unterstützen Studierende und erhalten später dann einen Teil von deren Lohn (sofern sie genug verdienen).
Zu den Diskussionen um die Gründung eines geisteswissenschaftlichen Elite-Colleges in England.
Zu den Diskussionen um die Gründung eines geisteswissenschaftlichen Elite-Colleges in England.
Die Zunahme an strukturierten Doktoratsprogrammen in den Geisteswissenschaften lähmen Kreativität und unabhängiges Denken und Forschen.
Die Zunahme an strukturierten Doktoratsprogrammen in den Geisteswissenschaften lähmen Kreativität und unabhängiges Denken und Forschen.
Zu den Ängsten der Geisteswissenschaften vor einer Quantifizierung ihrer Leistungen.
Zu den Ängsten der Geisteswissenschaften vor einer Quantifizierung ihrer Leistungen.
Beurteilung des neuen Horschulförderungsgesetzes.
Beurteilung des neuen Horschulförderungsgesetzes.
Ein Plädoyer für den (weiter gefassten) Nutzen der Geisteswissenschaften.
Ein Plädoyer für den (weiter gefassten) Nutzen der Geisteswissenschaften.
Kritische Gednaken zum heutigen PhD-System: es werden zu viele Doktoren produziert, die der akademische Markt nicht schlucken kann.
Kritische Gednaken zum heutigen PhD-System: es werden zu viele Doktoren produziert, die der akademische Markt nicht schlucken kann.
Zur Debatte, ob Fachhochschulen Doktorate anbieten sollen (wenn man von ihnen Forschung verlangt, solten sie - doch sollten sie Forschung machen?).
Zur Debatte, ob Fachhochschulen Doktorate anbieten sollen (wenn man von ihnen Forschung verlangt, solten sie - doch sollten sie Forschung machen?).
Wachsende Kritik am neuen Hochschulförderungsgesetz, das Forschung "steuern" will (grundfalscher Ansatz).
Wachsende Kritik am neuen Hochschulförderungsgesetz, das Forschung "steuern" will (grundfalscher Ansatz).
Eine scharfsinnige Analyse wie sich die Schwächen der Hochschulsysteme in Deutschland und der Schweiz gegenseitig stützen (nämlich das bekannte Problem des Missverhältnisses zwischen wenigen Professoren mit fixen Stellen und zahlreichen…
Eine scharfsinnige Analyse wie sich die Schwächen der Hochschulsysteme in Deutschland und der Schweiz gegenseitig stützen (nämlich das bekannte Problem des Missverhältnisses zwischen wenigen Professoren mit fixen Stellen und zahlreichen befristeten Stellen).
Die Fachhochschulen sollten - wenn sie schon angewandte Forschung machen sollen - auch entsprechend Nachwuchs fördern dürfen.
Die Fachhochschulen sollten - wenn sie schon angewandte Forschung machen sollen - auch entsprechend Nachwuchs fördern dürfen.
In den Jahren 2000-2010 haben die Schweizer Universitäten mehr Ehrendoktorate denn je verteilt - diese werden offensichtlich zu einem PR-Instrument der Hochschulen.
In den Jahren 2000-2010 haben die Schweizer Universitäten mehr Ehrendoktorate denn je verteilt - diese werden offensichtlich zu einem PR-Instrument der Hochschulen.
Der (richtige) Vorschlag, dass es in der Schweiz eine Zentrum für Höhere Studien geben sollte.
Der (richtige) Vorschlag, dass es in der Schweiz eine Zentrum für Höhere Studien geben sollte.
Warum es über kurz oder lang eine Selektion der Masterstudenten bei den Hochschulen brauchen wird (das muss so sein - ausser man will, dass alle Unis gleich schlecht sinid).
Warum es über kurz oder lang eine Selektion der Masterstudenten bei den Hochschulen brauchen wird (das muss so sein - ausser man will, dass alle Unis gleich schlecht sinid).
An den Schweizer Hochschulen prüft man eine restriktivere Zulassung ausländischer Master-Studenten. Faktisch bedeutet das eine weitere Entkopplung von Bachelor und Masters.
An den Schweizer Hochschulen prüft man eine restriktivere Zulassung ausländischer Master-Studenten. Faktisch bedeutet das eine weitere Entkopplung von Bachelor und Masters.
Zur Geschichte einer symbolträchtigen Universität: die Moskauer Universität der Völkerfreundschaft (in den letzten Jahren vorab Ziel russischer Rechtsextremer).
Zur Geschichte einer symbolträchtigen Universität: die Moskauer Universität der Völkerfreundschaft (in den letzten Jahren vorab Ziel russischer Rechtsextremer).
Gugerli zu einem Dilemma der ETH, die immer mehr erfolgreich Drittmittel einwirbt, was als Argument genommen wird, die Basisfinanzierung einzufrieren. Es ist absehbar, dass die ETH bald rote Zahlen schreiben…
Gugerli zu einem Dilemma der ETH, die immer mehr erfolgreich Drittmittel einwirbt, was als Argument genommen wird, die Basisfinanzierung einzufrieren. Es ist absehbar, dass die ETH bald rote Zahlen schreiben wird.
Blick auf die Hochschul-Lage in Grossbritannien, wo rund ein Viertel der Bewerber um Hochschulplätze leer ausgeht (ob das aber wirklich schlecht ist, ist so klar nicht - auch ein Problem…
Blick auf die Hochschul-Lage in Grossbritannien, wo rund ein Viertel der Bewerber um Hochschulplätze leer ausgeht (ob das aber wirklich schlecht ist, ist so klar nicht - auch ein Problem der Alternativen).
Zum neuen Hochschulgesetzt, das auch "harmonisieren" will (aufpassen!).
Zum neuen Hochschulgesetzt, das auch "harmonisieren" will (aufpassen!).
Eine Reportage aus der Singulairy-Universität - eine Art Sommerschule der Hochschul-Elite.
Eine Reportage aus der Singulairy-Universität - eine Art Sommerschule der Hochschul-Elite.
Eine interessante Beilage anlässlich des 550-Jahr-Jubiläums der Universität Basel.
Eine interessante Beilage anlässlich des 550-Jahr-Jubiläums der Universität Basel.
Zur (prekären) Lage des Hochschulwesens in Italien (und eine Übersicht, wie viel % vom BIP Staaten für die Bildung ausgeben).
Zur (prekären) Lage des Hochschulwesens in Italien (und eine Übersicht, wie viel % vom BIP Staaten für die Bildung ausgeben).
Eine sehr interessante Zusammenstellung der Probleme, die sich aus Output-Messung, Rankings etc. im Hochschulwesen ergeben. In der tat ist Input-Kontrolle Teil einer Gegenstrategie.
Eine sehr interessante Zusammenstellung der Probleme, die sich aus Output-Messung, Rankings etc. im Hochschulwesen ergeben. In der tat ist Input-Kontrolle Teil einer Gegenstrategie.
Offenbar wurde ein Manifest zur qualitativen Sozialforschung veröffentlicht (bestellen!).
Offenbar wurde ein Manifest zur qualitativen Sozialforschung veröffentlicht (bestellen!).
Zu den neuen Verfahren, Uni-Rankings zu erstellen (mit zwei Beispielen: Schanghai, Times Higher Education).
Zu den neuen Verfahren, Uni-Rankings zu erstellen (mit zwei Beispielen: Schanghai, Times Higher Education).
Interessanter Artikel zur wachsenden Symposien-(Un-)Kultur in den Geisteswissenschaften, die leider nicht zu Orten für Kontroversen, sondern zur intellektuellen Gleichschaltung werden (denn nichts normiert mehr als der Gruppendruck im halbwegs kleinen…
Interessanter Artikel zur wachsenden Symposien-(Un-)Kultur in den Geisteswissenschaften, die leider nicht zu Orten für Kontroversen, sondern zur intellektuellen Gleichschaltung werden (denn nichts normiert mehr als der Gruppendruck im halbwegs kleinen Kreis).
Wie im Zug der Bologna-REform nun auch das Doktorat reformiert werden soll (kürzer, weniger Abhängigkeit von einer Person, mehr Vernetzung)
Wie im Zug der Bologna-REform nun auch das Doktorat reformiert werden soll (kürzer, weniger Abhängigkeit von einer Person, mehr Vernetzung)
Beurteilung der "Deutschen-Debatte" in den Schweizer Hochschulen: die Probleme (in den Geisteswissenschaften) liegen ganz woanders.
Beurteilung der "Deutschen-Debatte" in den Schweizer Hochschulen: die Probleme (in den Geisteswissenschaften) liegen ganz woanders.
Zu den Unterschieden der "Nationalitätendebatte" bei den Professoren bei den Natur- und den Geisteswissenschaften.
Zu den Unterschieden der "Nationalitätendebatte" bei den Professoren bei den Natur- und den Geisteswissenschaften.
Wie sich die Fachhochschul-Landschaft in der Schweiz entwickelt.
Wie sich die Fachhochschul-Landschaft in der Schweiz entwickelt.
Überlegungen zum "Zwang" des lebenslangen Lernens (und was das für die Hochschulen bedeutet).
Überlegungen zum "Zwang" des lebenslangen Lernens (und was das für die Hochschulen bedeutet).
Warum es auch in der Schweiz eine Förderung der akademischen Elite geben sollte.
Warum es auch in der Schweiz eine Förderung der akademischen Elite geben sollte.
Ein sehr interessanter Vorschlag eines Studium Generale, das letztlich in eine Forderung nach der Schaffung zweier Arten von Universitäten führt (hatte man an sich ja schon, verschwimmt aber dadurch, indem…
Ein sehr interessanter Vorschlag eines Studium Generale, das letztlich in eine Forderung nach der Schaffung zweier Arten von Universitäten führt (hatte man an sich ja schon, verschwimmt aber dadurch, indem man die Fachhochschulen den Unis annähern will).
Die Idee der Universität als Stätten wissenschaftlicher Forschung. Doch dann darf man zur Frage der Vermassung nicht schweigen. Oder man kann auch generell die Frage stellen, wie das hier beschriebene…
Die Idee der Universität als Stätten wissenschaftlicher Forschung. Doch dann darf man zur Frage der Vermassung nicht schweigen. Oder man kann auch generell die Frage stellen, wie das hier beschriebene Wechselspiel von individuellem Nachdenken und kritischen kolletiven Diskutieren des Erdachten nicht auch in anderen Bereichen von Ausbildung wirken soll.
Der derzeitige Studentenprotest hat durchaus eine globalisierte Komponente. Und auch ein Punkt wird länderübergreifend diskutiert: zunehmende Gängelung durch schematische Studienordnungen.
Der derzeitige Studentenprotest hat durchaus eine globalisierte Komponente. Und auch ein Punkt wird länderübergreifend diskutiert: zunehmende Gängelung durch schematische Studienordnungen.
Beurteilung der Bologna-Reform durch Studierende. Die Kritik hält sich in Grenzen, weil die Verschulung den meisten Studierenden eher entspricht. Doch die leidenschaftlichen Forscher geraten unter die Räder.
Beurteilung der Bologna-Reform durch Studierende. Die Kritik hält sich in Grenzen, weil die Verschulung den meisten Studierenden eher entspricht. Doch die leidenschaftlichen Forscher geraten unter die Räder.
Zu den globalen Finanznöten der Universitäten und wie man diese angehen soll.
Zu den globalen Finanznöten der Universitäten und wie man diese angehen soll.
Eine Zwischenbilanz der Nationalen Forschungsschwerpunkte aus Sicht des SNF.
Eine Zwischenbilanz der Nationalen Forschungsschwerpunkte aus Sicht des SNF.
Einige Zahlen zu Bologna. Warum meint man mit Mobilität nur noch jene zwischen den CH-Unis (darum ging es ja ursprünglich nicht, sondern um die Mobilität zwischen grossen Kulturräumen - in…
Einige Zahlen zu Bologna. Warum meint man mit Mobilität nur noch jene zwischen den CH-Unis (darum ging es ja ursprünglich nicht, sondern um die Mobilität zwischen grossen Kulturräumen - in der Schweiz müsste man wenn schon jene zwischen den Sprachregionen anschauen). Die Verschulung ist augenfällig.
Resultate einer siebenjährigen Kampagne in Pakistan zur Förderung der Hochschulen - erstaunlich war die schlechte Ausgangslage, wenn man etwa mit Indien vergleicht.
Resultate einer siebenjährigen Kampagne in Pakistan zur Förderung der Hochschulen - erstaunlich war die schlechte Ausgangslage, wenn man etwa mit Indien vergleicht.
Sidler beurteilt das neue Gesetz zur Koordination der Hochschulen in der Schweiz (zu recht) kritisch.
Sidler beurteilt das neue Gesetz zur Koordination der Hochschulen in der Schweiz (zu recht) kritisch.
Der Gesetzesentwurf für das Schweizer Hochschulwesen ist verabschiedet worden. Das Akkreditierungssystem wird verschärft.
Der Gesetzesentwurf für das Schweizer Hochschulwesen ist verabschiedet worden. Das Akkreditierungssystem wird verschärft.
Das (Zerr-?)Bild der verökonomisierten Universität. Die Begrifflichkeit des so genannten "Neoliberalismus" ist einfach ungeeignet, um die Probleme zu erfassen.
Das (Zerr-?)Bild der verökonomisierten Universität. Die Begrifflichkeit des so genannten "Neoliberalismus" ist einfach ungeeignet, um die Probleme zu erfassen.
Wie die amerikanischen Top-Universitäten von der Finanzkrise schwer betroffen werden (da sie finanziell stark von ihren Fonds abhängig sind).
Wie die amerikanischen Top-Universitäten von der Finanzkrise schwer betroffen werden (da sie finanziell stark von ihren Fonds abhängig sind).
Weber zur Frage, ob man auch Geisteswissenschaften vergleichbar wie Naturwissenschaften evaluieren kann. Ja, man kann (Hinweis auf das Peer-Review beim Publizieren von Büchern im englischen System - das gibt es…
Weber zur Frage, ob man auch Geisteswissenschaften vergleichbar wie Naturwissenschaften evaluieren kann. Ja, man kann (Hinweis auf das Peer-Review beim Publizieren von Büchern im englischen System - das gibt es hier noch kaum).
Wie Sarkozy in einer REde das französische Hochschulwesen integral heruntergeputzt hat.
Wie Sarkozy in einer REde das französische Hochschulwesen integral heruntergeputzt hat.
Saner will ein studium generale an den Universitäten. Das will ich auch (sollte einmal mit ihm reden).
Saner will ein studium generale an den Universitäten. Das will ich auch (sollte einmal mit ihm reden).
Einige Vorschläge, wie die Hochschulen mehr Autonomie erhalten könnten.
Einige Vorschläge, wie die Hochschulen mehr Autonomie erhalten könnten.
Interview mit Hagner über den heutigen Status der Geisteswissenschaften im Wissenschaftsbetrieb.
Interview mit Hagner über den heutigen Status der Geisteswissenschaften im Wissenschaftsbetrieb.
Kritische Gedanken zur Frage, ob der Bologna-Prozess mit der Schweizer Hochschullandschaft kompatibel ist.
Kritische Gedanken zur Frage, ob der Bologna-Prozess mit der Schweizer Hochschullandschaft kompatibel ist.
Beurteilung der Frage, wie man mit Personalkonflikten mit Professoren an Universitäten umgehen soll. Kündigungen kommen sehr selten vor.
Beurteilung der Frage, wie man mit Personalkonflikten mit Professoren an Universitäten umgehen soll. Kündigungen kommen sehr selten vor.
OECD-Studie zu den Trends im Bildungswesen: Anteil von Studierenden in der Schweiz stagniert (glücklicherweise!) unter 40% und hat die Vermassung der anderen OECD-Staaten (über 50% im Schnitt) nicht mit.
OECD-Studie zu den Trends im Bildungswesen: Anteil von Studierenden in der Schweiz stagniert (glücklicherweise!) unter 40% und hat die Vermassung der anderen OECD-Staaten (über 50% im Schnitt) nicht mit.
Anton Hüglis Warnung vor einer zu engen Kopplung der Universitäten an die Wirtschaft (evt. mit einigen falschen Bildern: Unternehmen müssen nicht notwendigerweise derart hierarchisch organisiert sein).
Anton Hüglis Warnung vor einer zu engen Kopplung der Universitäten an die Wirtschaft (evt. mit einigen falschen Bildern: Unternehmen müssen nicht notwendigerweise derart hierarchisch organisiert sein).
Wie die Jurisprudenz in das amerikanische Universitätssystem einbebaut wurde (bis ins 19. Jahrhundert war das eine rein praktische Ausbildung bei Anwälten selbst).
Wie die Jurisprudenz in das amerikanische Universitätssystem einbebaut wurde (bis ins 19. Jahrhundert war das eine rein praktische Ausbildung bei Anwälten selbst).
Zum Umgang mit unethischem Verhalten in der Forschung am Beispiel USA: Das Office of Research Integrity.
Zum Umgang mit unethischem Verhalten in der Forschung am Beispiel USA: Das Office of Research Integrity.
Kritische Gedanken von Jost zu den Auswirkungen der Bologna-Reform auf die Hochschulen.
Kritische Gedanken von Jost zu den Auswirkungen der Bologna-Reform auf die Hochschulen.
Die ersten 8000 Bachelors der Fachhochschulen kommen auf den Arbeitsmarkt. Aber was soll diese Erfolgsmedlung, schon zuvor haben die Fachhochschulen (mehr) gleichwertige Abschlüsse produziert. Auswirkung von Bologna ist: weniger Präsenzunterricht,…
Die ersten 8000 Bachelors der Fachhochschulen kommen auf den Arbeitsmarkt. Aber was soll diese Erfolgsmedlung, schon zuvor haben die Fachhochschulen (mehr) gleichwertige Abschlüsse produziert. Auswirkung von Bologna ist: weniger Präsenzunterricht, mehr Administration.
Zur wachsenden Zahl der interdisziplinären Studien und Weiterbildungsangeboten. Ein zweiter Artikel handelt von der Notwendigkeit von Sabatticals von Lehrkräften.
Zur wachsenden Zahl der interdisziplinären Studien und Weiterbildungsangeboten. Ein zweiter Artikel handelt von der Notwendigkeit von Sabatticals von Lehrkräften.
Beispiel wie ein hochkompetitives und offenbar unmenschliches Arbeitsklima wissenschaftlicher Unsinn produziert (Chemie).
Beispiel wie ein hochkompetitives und offenbar unmenschliches Arbeitsklima wissenschaftlicher Unsinn produziert (Chemie).
Die Verschulung der Hochschule verstösst gegen deren eigentlichen Bildungsauftrag: was das für die psychologischen Beratungsstellen der Universitäten bedeutet.
Die Verschulung der Hochschule verstösst gegen deren eigentlichen Bildungsauftrag: was das für die psychologischen Beratungsstellen der Universitäten bedeutet.
Vernehmlassung des Gesetzes über die Förderung und Koordination der Hochschulen: Gefahr einer Verakademisierung der Fachhochschulen.
Vernehmlassung des Gesetzes über die Förderung und Koordination der Hochschulen: Gefahr einer Verakademisierung der Fachhochschulen.
Die grösste Universität der Welt ist in Mexico City: 360'000 Studierende, Dozierende etc.
Die grösste Universität der Welt ist in Mexico City: 360'000 Studierende, Dozierende etc.
Warum die Aufregung um die hohe Zahl ausländischer Dozenten an Schweizer Universitäten unangebracht sei.
Warum die Aufregung um die hohe Zahl ausländischer Dozenten an Schweizer Universitäten unangebracht sei.
Die Stellung der USA als führende Wissenschaftsmacht bröckelt (aber aufpassen, was man vergleicht!).
Die Stellung der USA als führende Wissenschaftsmacht bröckelt (aber aufpassen, was man vergleicht!).
Die Wirkung von nationalen Forschungsprogrammen wurde evaluiert: Wirkungen haben sie, aber Zielsetzung und Berichterstattung sei zu verbessern (was wohl auch heisst: Wirkungen kann man immer finden, doch waren sie auftragsgemäss?).…
Die Wirkung von nationalen Forschungsprogrammen wurde evaluiert: Wirkungen haben sie, aber Zielsetzung und Berichterstattung sei zu verbessern (was wohl auch heisst: Wirkungen kann man immer finden, doch waren sie auftragsgemäss?). Ein zweiter Artikel thematisiert die Auszeichnung von Dozenten.
Gesetz zur Hochschulkoordination geht in die Vernehmlassung.
Gesetz zur Hochschulkoordination geht in die Vernehmlassung.
10% der Geisteswissenschaftler hat nach Abschluss des Studiums noch keinen Job.
10% der Geisteswissenschaftler hat nach Abschluss des Studiums noch keinen Job.
Kohler über das Management von Universitäten: warum die Professoren mitreden sollten.
Kohler über das Management von Universitäten: warum die Professoren mitreden sollten.
Die so genannte Generation Praktikum existiert in Deutschland gemäss nun vorliegenden statistischen Zahlen nie in dem Ausmass, wie behauptet wurde (im Gegenteil - der Anteil jener, die kein Praktium macht,…
Die so genannte Generation Praktikum existiert in Deutschland gemäss nun vorliegenden statistischen Zahlen nie in dem Ausmass, wie behauptet wurde (im Gegenteil - der Anteil jener, die kein Praktium macht, nimmt zu).
Bemerkungen zur Diskussion um den ETH-Rat. Siehe dazu auch die NZZ vom 04.06., die NZZ am Sonntag vom 20.05. und die NZZ vom 14.06.
Bemerkungen zur Diskussion um den ETH-Rat. Siehe dazu auch die NZZ vom 04.06., die NZZ am Sonntag vom 20.05. und die NZZ vom 14.06.
Der Bologna-Prozess in Grossbritannien - man geht dort die Sache gelassener und ohne Eile an.
Der Bologna-Prozess in Grossbritannien - man geht dort die Sache gelassener und ohne Eile an.
Wie der Bologna-Prozess in Österreich umgesetzt wird: ein Musterland, doch Bologna addressiert nicht die wichtigen Probleme der Hochschullandschaft Österreich.
Wie der Bologna-Prozess in Österreich umgesetzt wird: ein Musterland, doch Bologna addressiert nicht die wichtigen Probleme der Hochschullandschaft Österreich.
Kritische Gedanken zur beruflichen Unsicherheit des akademischen Mittelbaus und wie das die Forschung beeinflusst.
Kritische Gedanken zur beruflichen Unsicherheit des akademischen Mittelbaus und wie das die Forschung beeinflusst.
Die US-Forschungsuniversitäten sollen von der strikten Departements-Struktur Abschied nehmen.
Die US-Forschungsuniversitäten sollen von der strikten Departements-Struktur Abschied nehmen.
Wie der Bologna-Prozess in den Niederlanden umgesetzt wird: teilweise einfach ein Umbenennen des Bestehenden (da das System schon recht Bologna-nah war).
Wie der Bologna-Prozess in den Niederlanden umgesetzt wird: teilweise einfach ein Umbenennen des Bestehenden (da das System schon recht Bologna-nah war).
An den Hochschulen soll der Druck auf die Studierenden zunehmen.
An den Hochschulen soll der Druck auf die Studierenden zunehmen.
Eine Zwischenbilanz zur Umsetzung der Bologna-Reform in der Schweiz.
Eine Zwischenbilanz zur Umsetzung der Bologna-Reform in der Schweiz.
Zu den problematischen Aspekten des Technologietransfers an den Hochschulen.
Zu den problematischen Aspekten des Technologietransfers an den Hochschulen.
Übersicht über die wichtigsten Hochschul-Rankings.
Übersicht über die wichtigsten Hochschul-Rankings.
Ein Zwischenstand zur Bologna-Reform in Frankreich. Das Finanzierungsproblem (u.a. fehlende Studiengebühren) bleibt ungelöst.
Ein Zwischenstand zur Bologna-Reform in Frankreich. Das Finanzierungsproblem (u.a. fehlende Studiengebühren) bleibt ungelöst.
Zu den Auswirkungen der Bologna-Reform auf die deutsche Hochschullandschaft: der Konformismus nimmt zu.
Zu den Auswirkungen der Bologna-Reform auf die deutsche Hochschullandschaft: der Konformismus nimmt zu.
Rund 10'000 US-Wissenschaftler haben sich in einer Petition gegen die Verpolitisierung der Wissenschaft in den USA gewandt (gegen Einmischung und Zensur).
Rund 10'000 US-Wissenschaftler haben sich in einer Petition gegen die Verpolitisierung der Wissenschaft in den USA gewandt (gegen Einmischung und Zensur).
Die ETH Zürich beginnt sich langsam gegen die ständige Bevorzugung der ETH Lausanne zu wehren (zu Recht).
Die ETH Zürich beginnt sich langsam gegen die ständige Bevorzugung der ETH Lausanne zu wehren (zu Recht).
Deutschland prämiert drei Universitäten als Exzellenz-Hochschulen (eine in Karlsruhe und zwei in München). Diese erhalten nun je 21 Mio euro zusätzlich pro Jahr (dazu kommen noch 18 Graduiertenschulen und 17…
Deutschland prämiert drei Universitäten als Exzellenz-Hochschulen (eine in Karlsruhe und zwei in München). Diese erhalten nun je 21 Mio euro zusätzlich pro Jahr (dazu kommen noch 18 Graduiertenschulen und 17 so genannte Exzellenzcluster – was die immer wieder für Worte finden).
Wie und wo man als Student seine Arbeiten kaufen kann (von Ghostwritern verfasst).
Wie und wo man als Student seine Arbeiten kaufen kann (von Ghostwritern verfasst).
Gedanken zur Frage, welche kontraproduktiven Wirkungen eine stärkere interne Führung einer Hochschule haben kann: Mehr Hektik und mehr Demotivation.
Gedanken zur Frage, welche kontraproduktiven Wirkungen eine stärkere interne Führung einer Hochschule haben kann: Mehr Hektik und mehr Demotivation.
Ein Bericht über den Berufseinstieg von Hochschulabgängern: nur wenige (12 Prozent) streben Selbstständigkeit an (doch ist das überraschend?).
Ein Bericht über den Berufseinstieg von Hochschulabgängern: nur wenige (12 Prozent) streben Selbstständigkeit an (doch ist das überraschend?).
Eine Analyse des Scheiterns von Hafen an der ETH Zürich, welche auch die Ambivalenz solcher Wandlungsprozesse aufzeigt (war Hafen der falsche Mann für das richtige Projekt?).
Eine Analyse des Scheiterns von Hafen an der ETH Zürich, welche auch die Ambivalenz solcher Wandlungsprozesse aufzeigt (war Hafen der falsche Mann für das richtige Projekt?).
Überlegungen zur Attraktivität einer akademischen Laufbahn: die akademische Freiheit wird immer mehr eingeengt unter anderem durch administrative Tätigkeit. Aufwendungen für die Lehre werden ebenfalls unterschätzt.
Überlegungen zur Attraktivität einer akademischen Laufbahn: die akademische Freiheit wird immer mehr eingeengt unter anderem durch administrative Tätigkeit. Aufwendungen für die Lehre werden ebenfalls unterschätzt.
Zum politischen Kampf über die Erhöhung der Bildungsausgaben: Bis zu zehn Prozent mehr Geld wird gefordert.
Zum politischen Kampf über die Erhöhung der Bildungsausgaben: Bis zu zehn Prozent mehr Geld wird gefordert.
Reportage über (offenbar unpolitische) Wohlfühl-Seminarien der ETH in der Toskana.
Reportage über (offenbar unpolitische) Wohlfühl-Seminarien der ETH in der Toskana.
Bericht über den Ingenieurmangel – weitgehend ein Ausdruck dafür, dass die Leute den einfachen Weg über die Geisteswissenschaften wählen (weil dort die Anforderungen heruntergeschraubt werden).
Bericht über den Ingenieurmangel – weitgehend ein Ausdruck dafür, dass die Leute den einfachen Weg über die Geisteswissenschaften wählen (weil dort die Anforderungen heruntergeschraubt werden).
Zur Einführung der Bologna-Reform an der Universität Zürich, wo nun fast alle Studiengänge neu sind.
Zur Einführung der Bologna-Reform an der Universität Zürich, wo nun fast alle Studiengänge neu sind.
Zum Stand der Dinge der Bologna-Reform an den Fachhochschulen – hier in ein positives Licht gerückt.
Zum Stand der Dinge der Bologna-Reform an den Fachhochschulen – hier in ein positives Licht gerückt.
Zum Begriff der Interdisziplinarität in der Forschung und den Problemen, die Qualität dieser Forschung zu bestimmen.
Zum Begriff der Interdisziplinarität in der Forschung und den Problemen, die Qualität dieser Forschung zu bestimmen.
Kurzer Artikel zur Gründung der Akademien der Wissenschaft Schweiz – einem Verbund der vier bestehenden Akademien.
Kurzer Artikel zur Gründung der Akademien der Wissenschaft Schweiz – einem Verbund der vier bestehenden Akademien.
Eine Beilage zum Wissensplatz Schweiz mit einer Vielzahl interessanter Zahlen und Fakten.
Eine Beilage zum Wissensplatz Schweiz mit einer Vielzahl interessanter Zahlen und Fakten.
Ein Plädoyer für die Erhaltung unzeitgemäss scheinender Rituale in den Universitäten, unter anderem die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht (was heisst: weniger Studenten pro Professor).
Ein Plädoyer für die Erhaltung unzeitgemäss scheinender Rituale in den Universitäten, unter anderem die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht (was heisst: weniger Studenten pro Professor).
Neue OECD-Zahlen über die Zahl der Hochschulabsolventen: Man kritisiert, die Schweiz habe eine geringe Quote von 27% Personen mit Hochschulzulassung (ist aber in Tat und Wahrheit zu hoch, solange man…
Neue OECD-Zahlen über die Zahl der Hochschulabsolventen: Man kritisiert, die Schweiz habe eine geringe Quote von 27% Personen mit Hochschulzulassung (ist aber in Tat und Wahrheit zu hoch, solange man noch ein funktionierendes Hochschulwesen hat). Und ein weiterer Artikel zur Förderung der Sozialwissenschaften in der Schweiz. Geht nicht ganz in die richtige Richtung, da man methodisch neues lernen muss und nicht ein Zentrum braucht, wo man noch mehr Sozialstudien macht.
Nigeria will offenbar gross in Wissenschaft investieren – gibt sicher schlechtere Arten, das Öl-Geld anzulegen.
Nigeria will offenbar gross in Wissenschaft investieren – gibt sicher schlechtere Arten, das Öl-Geld anzulegen.
Autonomie der Hochschulen führte vorab zu einer Bürokratisierung, die immer mehr Forschungszeit frisst.
Autonomie der Hochschulen führte vorab zu einer Bürokratisierung, die immer mehr Forschungszeit frisst.
Die ETH führt einen Eignungstest für Studenten ein.
Die ETH führt einen Eignungstest für Studenten ein.
Das Problem Quotenregelung an Universitäten am Beispiel Indien (hier geht es um die unteren Kasten).
Das Problem Quotenregelung an Universitäten am Beispiel Indien (hier geht es um die unteren Kasten).
Eine juristische (positive) Beurteilung des neuen Hochschulartikels.
Eine juristische (positive) Beurteilung des neuen Hochschulartikels.
Eine Vergleichsperspektive USA-EU. Interessante Zahlen. So sollen in den USA 5% der Bevölkerung studieren, in Europa nur 3%.
Eine Vergleichsperspektive USA-EU. Interessante Zahlen. So sollen in den USA 5% der Bevölkerung studieren, in Europa nur 3%.
Erstmals wurden Kostenberechnungen für Studienrichtungen und -orte publiziert. Generell sind Naturwissenschaften Kostenintensiv hinsichtlich Forschung und Geisteswissenschaften kostenintensiv hinsichtlich Lehre - doch für genaue Vergleiche eignen sich die Zahlen offenbar nicht.
Erstmals wurden Kostenberechnungen für Studienrichtungen und -orte publiziert. Generell sind Naturwissenschaften Kostenintensiv hinsichtlich Forschung und Geisteswissenschaften kostenintensiv hinsichtlich Lehre - doch für genaue Vergleiche eignen sich die Zahlen offenbar nicht.
Der Bologna-Prozess hat auch Auswirkungen auf die höhere Berufsbildung: sie bewirkt eine Verhochschulung.
Der Bologna-Prozess hat auch Auswirkungen auf die höhere Berufsbildung: sie bewirkt eine Verhochschulung.
Eine Ansicht, wie die Steuerung der Hochschulen nach Annahme des Bildungsartikels aussehen könnte.
Eine Ansicht, wie die Steuerung der Hochschulen nach Annahme des Bildungsartikels aussehen könnte.
Ein Porträt der berühmtesten öffentlichen Hochschule der USA: Berkeley.
Ein Porträt der berühmtesten öffentlichen Hochschule der USA: Berkeley.
Beurteilung der Hochschulautonomie aufgrund des neuen Bildungsartikels in der Schweiz.
Beurteilung der Hochschulautonomie aufgrund des neuen Bildungsartikels in der Schweiz.
Beispiele von e-Learning an der Universität Bern.
Beispiele von e-Learning an der Universität Bern.
Zur Rolle von Professorenbewertungen durch Studenten für das Ranking von Universitäten. Dazu ein Artikel über Seniorenstudenten.
Zur Rolle von Professorenbewertungen durch Studenten für das Ranking von Universitäten. Dazu ein Artikel über Seniorenstudenten.
Verschiedene Modelle, wie in der Schweiz die wissenschaftspolitischen Gremien organisiert werden sollen.
Verschiedene Modelle, wie in der Schweiz die wissenschaftspolitischen Gremien organisiert werden sollen.
Ein wichtiger Artikel über die Rolle der Privatdozenten an den Universitäten, welche den Laden am laufen halten, aber meist ignoriert werden.
Ein wichtiger Artikel über die Rolle der Privatdozenten an den Universitäten, welche den Laden am laufen halten, aber meist ignoriert werden.
Ein ganzes Bündel von Artikeln anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der ETH. Auch mit Blick auf Lausanne, einem historischen Rückblick, einem Artikel ur Einbindung des Hochschul-Managements, zur Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und…
Ein ganzes Bündel von Artikeln anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der ETH. Auch mit Blick auf Lausanne, einem historischen Rückblick, einem Artikel ur Einbindung des Hochschul-Managements, zur Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und zur Frage nach der Bedeutung der Geisteswissenschaften an der ETH. Vgl. dazu auch mit dem Bulletin der ETH vom 01.05.
Vorschlag, dass es Instrumente für die Beurteilung der Qualität in der Hochschullehre brauche, in Form eines Instituts.
Vorschlag, dass es Instrumente für die Beurteilung der Qualität in der Hochschullehre brauche, in Form eines Instituts.
Hinwese auf die neue gesetzliche Regelung des Schweizer Hochschulwesens ab 2008.
Hinwese auf die neue gesetzliche Regelung des Schweizer Hochschulwesens ab 2008.
Zum Aufbau der Systembiologie in Basel.
Zum Aufbau der Systembiologie in Basel.
Eine ganz spezielle Universität in Zentralasien: eine Gebirgsuniversität in Kirgistan.
Eine ganz spezielle Universität in Zentralasien: eine Gebirgsuniversität in Kirgistan.
Ein Versuch, die Bildungsrendite von Hochschulstudien auszurechnen, Diese sollen im internationalen Vergleich sehr tief sein. Da wüsste man aber gerne, wie genau man diese ausrechnet.
Ein Versuch, die Bildungsrendite von Hochschulstudien auszurechnen, Diese sollen im internationalen Vergleich sehr tief sein. Da wüsste man aber gerne, wie genau man diese ausrechnet.
Ein Plädoyer für höhere Studiengebühren und Studienkredite statt Stipendien.
Ein Plädoyer für höhere Studiengebühren und Studienkredite statt Stipendien.
Überblick über die Evaluationsmethoden von Hochschulforschung vorab im Bereich Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften. Ein weiterer Artikel thematisiert das Verhältnis zwischen Hochschulen und Wirtschaft.
Überblick über die Evaluationsmethoden von Hochschulforschung vorab im Bereich Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften. Ein weiterer Artikel thematisiert das Verhältnis zwischen Hochschulen und Wirtschaft.
Hinweis auf ein Buch, das die geschichtlichen Wurzeln des Humbold-Universitätsideals nachzeichnet.
Hinweis auf ein Buch, das die geschichtlichen Wurzeln des Humbold-Universitätsideals nachzeichnet.
Interessanter Blick auf die Universitäten Westafrikas. Diese waren zur Mitte des 20. Jahrhunderts gar nicht so schlecht, doch danach folgte ein markanter Niedergang. Deshalb werden immer mehr Privatuniversitäten aufgebaut.
Interessanter Blick auf die Universitäten Westafrikas. Diese waren zur Mitte des 20. Jahrhunderts gar nicht so schlecht, doch danach folgte ein markanter Niedergang. Deshalb werden immer mehr Privatuniversitäten aufgebaut.
Ein ausführlicher Vergleich USA-Europa hinsichtlich Zitationen, Zahl der Publikationen und das Geld, das dafür aufgewendet wurde. Grossbritannien ist diesbezüglich am effizientesten.
Ein ausführlicher Vergleich USA-Europa hinsichtlich Zitationen, Zahl der Publikationen und das Geld, das dafür aufgewendet wurde. Grossbritannien ist diesbezüglich am effizientesten.
Wie die Literaturwissenschaften an der ETH eliminiert wurden.
Wie die Literaturwissenschaften an der ETH eliminiert wurden.
Was Führungspersonen im Universitätsbereich noch oft tun: der Ruf nach Ethik. Hier am Beispiel Waldvogel (ETH).
Was Führungspersonen im Universitätsbereich noch oft tun: der Ruf nach Ethik. Hier am Beispiel Waldvogel (ETH).
Warum Kleiberts Vision Hochschullandschaft 2008 Unsinn sein soll. Und Haering skizziert, wie die Hochschullandschaft 2010 aussehen soll.
Warum Kleiberts Vision Hochschullandschaft 2008 Unsinn sein soll. Und Haering skizziert, wie die Hochschullandschaft 2010 aussehen soll.
Vergleich der ETH mit britischen Hochschulen. Generell ist in England die Bezahlung zu tief.
Vergleich der ETH mit britischen Hochschulen. Generell ist in England die Bezahlung zu tief.
Ein Porträt des Collegium Budapest.
Ein Porträt des Collegium Budapest.
Kritische Stimmen in den USA, wonach immer mehr Stellen im Forschungsbetrieb nach politischen Erwägungen besetzt werden.
Kritische Stimmen in den USA, wonach immer mehr Stellen im Forschungsbetrieb nach politischen Erwägungen besetzt werden.
Ein treffender Artikel vom Höffe über die Auswirkungen der Evalutionitis auf die Hochschulen.
Ein treffender Artikel vom Höffe über die Auswirkungen der Evalutionitis auf die Hochschulen.
Zu den Tücken der Universitätslaufbahn. Die gescheiterten landen vorab in der öffentlichen Verwaltung. Was bedeutet das eigentlich für die Verwaltung?
Zu den Tücken der Universitätslaufbahn. Die gescheiterten landen vorab in der öffentlichen Verwaltung. Was bedeutet das eigentlich für die Verwaltung?
Zum Problem, wie man die Qualität von Nachdiplomstudien an Fachhochschulen bewerten soll. Hier wird viel Etikettenschwindel betrieben.
Zum Problem, wie man die Qualität von Nachdiplomstudien an Fachhochschulen bewerten soll. Hier wird viel Etikettenschwindel betrieben.
Zu den negativen Folgen der Evaluation: Ausrichtung der Forschung auf die evaluationsrelevanten Parameter. Man sollte einmal untersuchen, ob das tatsächlich stattfindet.
Zu den negativen Folgen der Evaluation: Ausrichtung der Forschung auf die evaluationsrelevanten Parameter. Man sollte einmal untersuchen, ob das tatsächlich stattfindet.
Bericht über eine Studie von Avenir Suisse über das Hochschulwesen in der Schweiz.
Bericht über eine Studie von Avenir Suisse über das Hochschulwesen in der Schweiz.
Zum Aufbau der Systembiologie in Basel und Zürich. Vgl. dazu auch die BaZ vom gleichen Tag.
Zum Aufbau der Systembiologie in Basel und Zürich. Vgl. dazu auch die BaZ vom gleichen Tag.
Ein Porträt des Wissenschaftskollegs Berlin – eine wirklich interessante Institution.
Ein Porträt des Wissenschaftskollegs Berlin – eine wirklich interessante Institution.
Argumente gegen die Idee von Studiendarlehen, z.B. weil solche die Gründung von Familien noch mehr erschwere.
Argumente gegen die Idee von Studiendarlehen, z.B. weil solche die Gründung von Familien noch mehr erschwere.
Zum Problem der Akkreditierung im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften in Europa.
Zum Problem der Akkreditierung im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften in Europa.
Ein historischer Rückblick auf die Entstehung des ETH-Gesetzes.
Ein historischer Rückblick auf die Entstehung des ETH-Gesetzes.
Hier das Plädoyer für höhere Studiengebühren und ein System staatlicher Studiendarlehen.
Hier das Plädoyer für höhere Studiengebühren und ein System staatlicher Studiendarlehen.
Zum Stand der Diskussion über Systembiologie in Basel.
Zum Stand der Diskussion über Systembiologie in Basel.
Inwiefern das Bachelor-Studium Sinn macht - bei gewissen Studiengängen ist das mit Sicherheit Unsinn.
Inwiefern das Bachelor-Studium Sinn macht - bei gewissen Studiengängen ist das mit Sicherheit Unsinn.
Eine Rangliste der Universitäten in der Schweiz.
Eine Rangliste der Universitäten in der Schweiz.
Hier eine Antwort auf die Frage, wofür die Geisteswissenschaften gut sein sollen.
Hier eine Antwort auf die Frage, wofür die Geisteswissenschaften gut sein sollen.
Die Uni Zürich beteiligt sich am Collegium Helveticum.
Die Uni Zürich beteiligt sich am Collegium Helveticum.
Auf Fachhochschul-Stufe soll es so genannte nationale Kompetenznetze geben. Hier ist die entsprechende Liste.
Auf Fachhochschul-Stufe soll es so genannte nationale Kompetenznetze geben. Hier ist die entsprechende Liste.
Politische Forderungen des Bundes demokratischer WissenschaftlerInnen mit Blick auf den Bologna-Prozess in Deutschland.
Politische Forderungen des Bundes demokratischer WissenschaftlerInnen mit Blick auf den Bologna-Prozess in Deutschland.
Eine Übersicht über verschiedene Projekte zur Gründung einer privaten Universität. Am 17.11.03 zudem ein Artikel zur Frage, wie private Universitäten Anerkennung suchen.
Eine Übersicht über verschiedene Projekte zur Gründung einer privaten Universität. Am 17.11.03 zudem ein Artikel zur Frage, wie private Universitäten Anerkennung suchen.
Die Forscher müssen immer mehr managen und haben keine Zeit mehr zum forschen (sollte man mal quantifizieren).
Die Forscher müssen immer mehr managen und haben keine Zeit mehr zum forschen (sollte man mal quantifizieren).
Wie die OECD die Schweizer Hochschullandschaft sieht. Unter anderem sollten die Humanwissenschaften mehr gestärkt werden.
Wie die OECD die Schweizer Hochschullandschaft sieht. Unter anderem sollten die Humanwissenschaften mehr gestärkt werden.
Generell kritischer Artikel zu Universitäts-Rankings mit den Kernargumenten dagegen.
Generell kritischer Artikel zu Universitäts-Rankings mit den Kernargumenten dagegen.
Drei Diskussionsbeiträge zur Teilrevision des Fachhochschulgesetzes.
Drei Diskussionsbeiträge zur Teilrevision des Fachhochschulgesetzes.
Zur Geschichte der ETH in Lausanne, die einst als Privatschule begann.
Zur Geschichte der ETH in Lausanne, die einst als Privatschule begann.
Europa produziert mehr Uni-Absolventen als die USA und Japan – in absoluten Zahlen, was ja ein unsinniger Vergleich ist. Zudem wäre es auch ein schlechtes Zeichen, wenn es pro Kopf…
Europa produziert mehr Uni-Absolventen als die USA und Japan – in absoluten Zahlen, was ja ein unsinniger Vergleich ist. Zudem wäre es auch ein schlechtes Zeichen, wenn es pro Kopf wirklich so wäre.
Bemerkungen dazu, dass die dauernden Evaluationen im Hochschulbereich das System unter Stress setzen.
Bemerkungen dazu, dass die dauernden Evaluationen im Hochschulbereich das System unter Stress setzen.
Warum bricht ein Viertel der Studenten mit dem Studium ab. Eine SNF-Studie behauptet, dies habe mit der veränderten Lebenswelt der Studenten zu tun. Doch Leute adaptieren ihre Lebenswelten vielleicht auch…
Warum bricht ein Viertel der Studenten mit dem Studium ab. Eine SNF-Studie behauptet, dies habe mit der veränderten Lebenswelt der Studenten zu tun. Doch Leute adaptieren ihre Lebenswelten vielleicht auch im Wissen, dass sie eigentlich gar nicht studieren wollen bzw. den Anforderungen nicht gewachsen sind.
Zum Konzept der „Champions-League“ der Forschungsinstitutionen des CEST.
Zum Konzept der „Champions-League“ der Forschungsinstitutionen des CEST.
Hier ein Plädoyer für die Geisteswissenschaften von Höffe.
Hier ein Plädoyer für die Geisteswissenschaften von Höffe.
Warum man Fachhochschulen nicht als Unternehmen auffassen sollte.
Warum man Fachhochschulen nicht als Unternehmen auffassen sollte.
Zwei Zürcher Sichtweisen zur Hochschulpolitik (Osterwalder/Weder): Eher eine Sammlung von Gedanken als ein klarer Schwerpunkt. Zwei weitere Ansichten kommen von Economiesuisse und aus Genf.
Zwei Zürcher Sichtweisen zur Hochschulpolitik (Osterwalder/Weder): Eher eine Sammlung von Gedanken als ein klarer Schwerpunkt. Zwei weitere Ansichten kommen von Economiesuisse und aus Genf.
Im Tessin soll ein „biomedizinischer Pol“ mit entsprechenden Forschungsinstituten entstehen.
Im Tessin soll ein „biomedizinischer Pol“ mit entsprechenden Forschungsinstituten entstehen.
Plädoyer dagegen, Wissenschaft nur nach ihrer Nutzbarkeit zu bewerten. Letztlich ist Wissenschaft auch (unnütze) Kultur.
Plädoyer dagegen, Wissenschaft nur nach ihrer Nutzbarkeit zu bewerten. Letztlich ist Wissenschaft auch (unnütze) Kultur.
Plädoyer für eine Revision des ETH-Gesetzes. So brauche es beispielsweise keinen ETH-Rat.
Plädoyer für eine Revision des ETH-Gesetzes. So brauche es beispielsweise keinen ETH-Rat.
Eine Zwischenbilanz nach sechs Jahren Reform der Fachhochschulen - Mängel im Bereich der angewandten Forschung. Ein zweiter Artikel zu den neuen Wegen, private Universitäten finanzieren zu können.
Eine Zwischenbilanz nach sechs Jahren Reform der Fachhochschulen - Mängel im Bereich der angewandten Forschung. Ein zweiter Artikel zu den neuen Wegen, private Universitäten finanzieren zu können.
Zur Frage des interkantonalen Finanzausgleichs zur Deckung der Kosten im Bereich Lehre. Die Mediziner sind am teuersten.
Zur Frage des interkantonalen Finanzausgleichs zur Deckung der Kosten im Bereich Lehre. Die Mediziner sind am teuersten.
Novartis baut ein Forschungszentrum in den USA auf.
Novartis baut ein Forschungszentrum in den USA auf.
Eine Diskussion unter Sozialwissenschaftlern über die Vernetzung ihrer Forschung. Vgl. dazu auch mit dem Bund vom 27.03.02.
Eine Diskussion unter Sozialwissenschaftlern über die Vernetzung ihrer Forschung. Vgl. dazu auch mit dem Bund vom 27.03.02.
Stabübergabe bei der SAGW: Beat Sitter-Liver tritt ab.
Stabübergabe bei der SAGW: Beat Sitter-Liver tritt ab.
Eine gute Polemik gegen die aktuelle Hochschulpolitik (als Gütekriterium gelte z.B. die Höhe der verlangten Gelder…).
Eine gute Polemik gegen die aktuelle Hochschulpolitik (als Gütekriterium gelte z.B. die Höhe der verlangten Gelder…).
Zur Frage, wie es zu den verschiedenen Wissenskulturen gekommen ist (insb. die Abspaltung der Naturwissenschaften und besonders der Biowissenschaften).
Zur Frage, wie es zu den verschiedenen Wissenskulturen gekommen ist (insb. die Abspaltung der Naturwissenschaften und besonders der Biowissenschaften).
Zu den verschiedenen Neuerungen in den Schweizer und den deutschen Hochschulen, tenure-track, Junior-Professuren, Assistenz- und Förderprofessuren.
Zu den verschiedenen Neuerungen in den Schweizer und den deutschen Hochschulen, tenure-track, Junior-Professuren, Assistenz- und Förderprofessuren.
Hinweise auf zunehmendes Sponsoring in Schweizer Hochschulen.
Hinweise auf zunehmendes Sponsoring in Schweizer Hochschulen.
Zur Diskussion, ob es auch bei den Geisteswissenschaften tenure-track geben soll oder doch lieber die Habilitation. Hier wird für ersteres plädiert.
Zur Diskussion, ob es auch bei den Geisteswissenschaften tenure-track geben soll oder doch lieber die Habilitation. Hier wird für ersteres plädiert.
Zur Vernehmlassung des neuen Hochschulartikels. Knackpunkt ist die Autonomie der Hochschulen und die Frage der Zusammenarbeit und deren Steuerung.
Zur Vernehmlassung des neuen Hochschulartikels. Knackpunkt ist die Autonomie der Hochschulen und die Frage der Zusammenarbeit und deren Steuerung.
Auch bei den Deutschen müssen die Geisteswissenschaften unten durch.
Auch bei den Deutschen müssen die Geisteswissenschaften unten durch.
Eine Übersicht zu den Folgen des Bologna-Prozesses für die Schweizer Hochschulen.
Eine Übersicht zu den Folgen des Bologna-Prozesses für die Schweizer Hochschulen.
Ein Porträt der National Institutes of Health in den USA (Bethesda).
Ein Porträt der National Institutes of Health in den USA (Bethesda).
Zu den steigenden Hochschul-Gebühren in den USA sowie das Phänomen, dass immer mehr Begüterte vom an sich gut ausgebauten Stipendienwesen profitieren.
Zu den steigenden Hochschul-Gebühren in den USA sowie das Phänomen, dass immer mehr Begüterte vom an sich gut ausgebauten Stipendienwesen profitieren.
Eine kritische Betrachtung des Bologna-Prozesses. Dadurch werde Mittelmässigkeit gefördert.
Eine kritische Betrachtung des Bologna-Prozesses. Dadurch werde Mittelmässigkeit gefördert.
Universität und ETH Zürich unterzeichnen einen Kooperationsvertrag.
Universität und ETH Zürich unterzeichnen einen Kooperationsvertrag.
Schatz äussert sich zum Problem der fehlenden Laufbahn-Perspektiven junger Wissenschaftler - ein Plädoyer für tenure track.
Schatz äussert sich zum Problem der fehlenden Laufbahn-Perspektiven junger Wissenschaftler - ein Plädoyer für tenure track.
Ein Rückblick auf 30 Jahre Biozentrum Basel. Dazu gibt es auch eine Pressemeldung.
Ein Rückblick auf 30 Jahre Biozentrum Basel. Dazu gibt es auch eine Pressemeldung.
Obgleich der Universalgelehrte abgedankt hat, bilden sich neue Verbindungslinien zwischen Wissenschaft, Technik und Kunst.
Obgleich der Universalgelehrte abgedankt hat, bilden sich neue Verbindungslinien zwischen Wissenschaft, Technik und Kunst.
Worin besteht eigentlich der Amerikanisierungsdruck bei den Hochschulen? Hierzu einige Antworten.
Worin besteht eigentlich der Amerikanisierungsdruck bei den Hochschulen? Hierzu einige Antworten.
Porträt des Amgen-Institues - ein kleines, sehr erfolgreiches Institut in Kanada.
Porträt des Amgen-Institues - ein kleines, sehr erfolgreiches Institut in Kanada.
Was die Bolognareform am Beispiel der Rechtswissenschaften bedeutet.
Was die Bolognareform am Beispiel der Rechtswissenschaften bedeutet.
Zur Qualitätssicherung bei den Sozialwissenschaften.
Zur Qualitätssicherung bei den Sozialwissenschaften.
Die Rede der „zwei Kulturen“ muss nicht unbedingt eine korrekte Klassifizierung nach sich ziehen. Ein kulturwissenschaftlicher Blick kann hier andere Grenzen offen legen.
Die Rede der „zwei Kulturen“ muss nicht unbedingt eine korrekte Klassifizierung nach sich ziehen. Ein kulturwissenschaftlicher Blick kann hier andere Grenzen offen legen.
Zur kulturwissenschaftlichen Herausforderung der Geisteswissenschaft – dahinter verbirgt sich die Forderung, dass sich die Geisteswissenschaften vermehrt gesellschaftlichen Fragen annehmen soll (wie genau werden diese definiert?).
Zur kulturwissenschaftlichen Herausforderung der Geisteswissenschaft – dahinter verbirgt sich die Forderung, dass sich die Geisteswissenschaften vermehrt gesellschaftlichen Fragen annehmen soll (wie genau werden diese definiert?).
Ein Plädoyer für die Gleichbehandlung von Fachhochschulen und Universitäten. Vorab die Bevorzugung der ETH wird angegriffen.
Ein Plädoyer für die Gleichbehandlung von Fachhochschulen und Universitäten. Vorab die Bevorzugung der ETH wird angegriffen.
Ansichten von Weder zum neuen Hochschulartikel, der in Vorbereitung ist.
Ansichten von Weder zum neuen Hochschulartikel, der in Vorbereitung ist.
Zum Stand der Arbeit zum neuen Hochschulartikel in der Bundesverwaltung.
Zum Stand der Arbeit zum neuen Hochschulartikel in der Bundesverwaltung.
Zur Frage, wie man die Qualität der Geisteswissenschaften messen soll. Vgl. dazu auch das Interview mit von Matt im Tages Anzeiger vom 22.02.02.
Zur Frage, wie man die Qualität der Geisteswissenschaften messen soll. Vgl. dazu auch das Interview mit von Matt im Tages Anzeiger vom 22.02.02.
Zu einem Symposium der vier Akademien der Schweiz zur Forschungspolitik.
Zu einem Symposium der vier Akademien der Schweiz zur Forschungspolitik.
Hier werden die Pro-Argumenten für die Bologna-Reform zusammengefasst. In einem weiteren Artikel erläutert Zimmerli die Idee einer privaten Universität. In einem dritten Artikel wird kritisch gegen Evaluationen im Hochschulbereich Stellung…
Hier werden die Pro-Argumenten für die Bologna-Reform zusammengefasst. In einem weiteren Artikel erläutert Zimmerli die Idee einer privaten Universität. In einem dritten Artikel wird kritisch gegen Evaluationen im Hochschulbereich Stellung bezogen. Und Zimmerli schreibt schliesslich, welchen künftigen Aufgaben sich die Hochschulen stellen müssen.
Eichenbergers Thesen über den Vorbildscharakter der USA für die Hochschulorganisation.
Eichenbergers Thesen über den Vorbildscharakter der USA für die Hochschulorganisation.
Zum Aufbau einer Universität im Tessin.
Zum Aufbau einer Universität im Tessin.
Forderung nach einem Koordinationsorgan für die Wissenschaftspolitik.
Forderung nach einem Koordinationsorgan für die Wissenschaftspolitik.
Zur wirtschaftlichen Bedeutung des technologietransfers – vorab im Kontext der New Economy.
Zur wirtschaftlichen Bedeutung des technologietransfers – vorab im Kontext der New Economy.
Bericht zur Website www.swiss-science.org – wo man alles zur Forschungspolitik der Schweiz findet.
Bericht zur Website www.swiss-science.org – wo man alles zur Forschungspolitik der Schweiz findet.
Schatz präsentiert seine Thesen zur Forschungspolitik: Für die Förderung von Eliten.
Schatz präsentiert seine Thesen zur Forschungspolitik: Für die Förderung von Eliten.
An US-Universitäten entstehen immer mehr interdisziplinäre Institute.
An US-Universitäten entstehen immer mehr interdisziplinäre Institute.
Zwischenstand zum virtuellen Campus., Vgl. dazu auch mit der NZZ vom 07.11.00 und mit der Weltwoche vom 18.05.00.
Zwischenstand zum virtuellen Campus., Vgl. dazu auch mit der NZZ vom 07.11.00 und mit der Weltwoche vom 18.05.00.
Ein amerikanischer Millionär will eine gebührenfreie Internet-Universität aufbauen – was natürlich nur die Lehre betreffen kann.
Ein amerikanischer Millionär will eine gebührenfreie Internet-Universität aufbauen – was natürlich nur die Lehre betreffen kann.
Zur Schliessung des Basler Instituts für Immunologie. Dazu habe ich auch ein ganzes Bündel Agenturmeldungen.
Zur Schliessung des Basler Instituts für Immunologie. Dazu habe ich auch ein ganzes Bündel Agenturmeldungen.
Ein historischer Rückblick auf die Entstehung der Fachhochschulen in der Schweiz.
Ein historischer Rückblick auf die Entstehung der Fachhochschulen in der Schweiz.
Zur Neugestaltung des Wissenschaftsrats.
Zur Neugestaltung des Wissenschaftsrats.
Kohler philosophiert über „Wissen ist Macht“.
Kohler philosophiert über „Wissen ist Macht“.
Einige kritischen Gedanken zur Vernaturwissenschaftlichung der technischen Hochschulen.
Einige kritischen Gedanken zur Vernaturwissenschaftlichung der technischen Hochschulen.
Genf und Lausanne wollen im Bereich Biologie stärker zusammenspannen.
Genf und Lausanne wollen im Bereich Biologie stärker zusammenspannen.
Vergleich der Kostenstruktur der ETHZ, Uni Basel, und zwei Hochschulen aus Aachen und Bielefeld. Die Schweizer haben tiefere Personalkosten.
Vergleich der Kostenstruktur der ETHZ, Uni Basel, und zwei Hochschulen aus Aachen und Bielefeld. Die Schweizer haben tiefere Personalkosten.
Wie an der Universität Basel neue interdisziplinäre Bereiche entstehen.
Wie an der Universität Basel neue interdisziplinäre Bereiche entstehen.
Zur Bedeutung der wissenschaftlichen Politikberatung am Beispiel Grossbritannien.
Zur Bedeutung der wissenschaftlichen Politikberatung am Beispiel Grossbritannien.
Die ETH soll neu Leistungsziele statt Mittelvorgaben erhalten.
Die ETH soll neu Leistungsziele statt Mittelvorgaben erhalten.
Kritik an der Schweizer Hochschulpolitik, welche Konformismus und Bürokratie fördere.
Kritik an der Schweizer Hochschulpolitik, welche Konformismus und Bürokratie fördere.
Zu den deutschen Massenuniversitäten und der Vielzahl der Probleme, die das mit sich bringt. Zudem ein Artikel zu Grossbritannien, wo Blair anstrebt, dass die Hälfte der Bevölkerung studieren soll (welch…
Zu den deutschen Massenuniversitäten und der Vielzahl der Probleme, die das mit sich bringt. Zudem ein Artikel zu Grossbritannien, wo Blair anstrebt, dass die Hälfte der Bevölkerung studieren soll (welch ein Unsinn). Und ein Porträt der Berner Fachhochschule. Sowie eine Einschätzung der Perspektiven der Informationstechnologie für Lehre und Forschung (vor allem e-Learning).
Hier erklärt Kleiber sein (diffuses) Netzwerk.
Hier erklärt Kleiber sein (diffuses) Netzwerk.
Warum Sozial- und Geisteswissenschaften an der ETH aufgewertet werden sollen. Siehe dazu auch die NZZ vom 10.09.99.
Warum Sozial- und Geisteswissenschaften an der ETH aufgewertet werden sollen. Siehe dazu auch die NZZ vom 10.09.99.
Man sollte in der Forschungspolitik wirtschaftliche Faktoren nicht zu hoch gewichten.
Man sollte in der Forschungspolitik wirtschaftliche Faktoren nicht zu hoch gewichten.
Die Bologna-Erklärung im Wortlaut.
Die Bologna-Erklärung im Wortlaut.
Eine Zwischenbilanz von Kleiber. Auch hier ist das „Netzwerk“ omnipräsent.
Eine Zwischenbilanz von Kleiber. Auch hier ist das „Netzwerk“ omnipräsent.
Ein Kommentar des Wissenschaftsrats zur bundesrätlichen Forschungspolitik: unter anderem Forderung nach höheren Studiengebühren.
Ein Kommentar des Wissenschaftsrats zur bundesrätlichen Forschungspolitik: unter anderem Forderung nach höheren Studiengebühren.
Wo es die höchste Dichte an Forschungsstätten im Bereich Neurowissenschaft haben soll: San Diego.
Wo es die höchste Dichte an Forschungsstätten im Bereich Neurowissenschaft haben soll: San Diego.
Eine Rangliste (impact in verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten), welche die US-amerikanische Dominanz zeigt.
Eine Rangliste (impact in verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten), welche die US-amerikanische Dominanz zeigt.
Zwischenbericht zur Einführung des New Public Managements bei den Hochschulen. Und ein Bericht über die wissenschaftpolitischen Beratungsorgane in verschiedenen europäischen Ländern, sowie über neue Grundlagen zu Monitoring und Evaluation.
Zwischenbericht zur Einführung des New Public Managements bei den Hochschulen. Und ein Bericht über die wissenschaftpolitischen Beratungsorgane in verschiedenen europäischen Ländern, sowie über neue Grundlagen zu Monitoring und Evaluation.
Bericht über den Kreditrahmen des Bundes für Bildung, Forschung und Technologie bis 2003.
Bericht über den Kreditrahmen des Bundes für Bildung, Forschung und Technologie bis 2003.
Was Transdisziplinarität bedeuten kann – auch für die Ingenieurswissenschaften.
Was Transdisziplinarität bedeuten kann – auch für die Ingenieurswissenschaften.
Zur Evaluation der Geisteswissenschaften.
Zur Evaluation der Geisteswissenschaften.