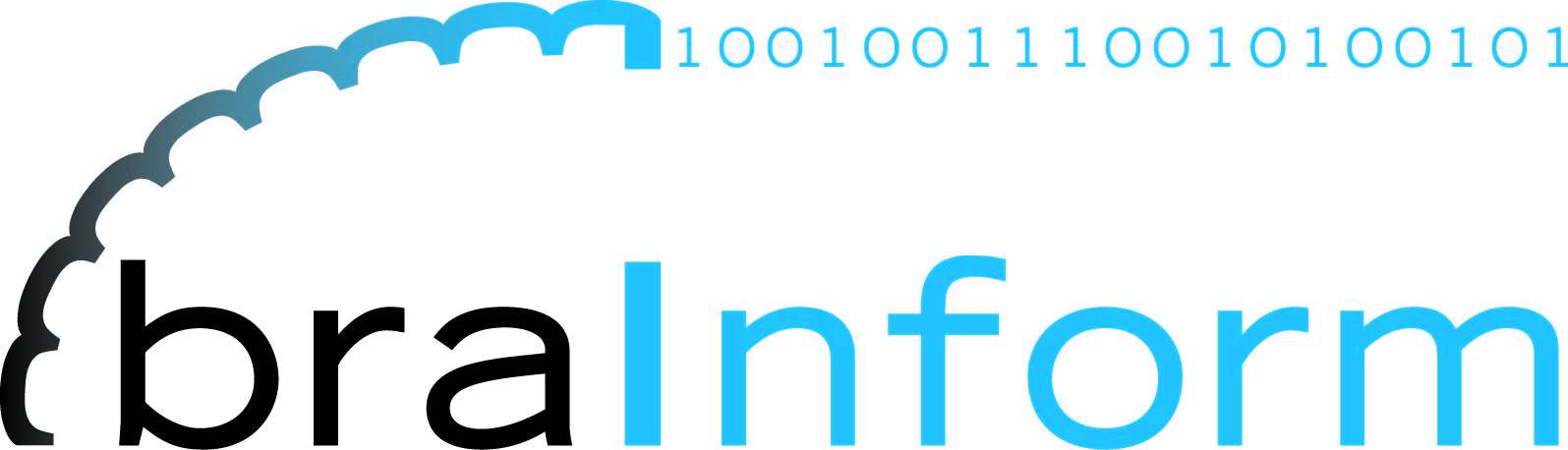Offenbar war das Modell, worauf sich der Club of Rome abstützte, kybernetisch inspiriert - ein weiteres Beispiel des grossartigen Scheiterns von Comutermodellen.
Offenbar war das Modell, worauf sich der Club of Rome abstützte, kybernetisch inspiriert - ein weiteres Beispiel des grossartigen Scheiterns von Comutermodellen.
Interview mit dem Komplexitäts-Forscher Peter Tarchin zum Zusammenbruch von Gesellschaften.
Interview mit dem Komplexitäts-Forscher Peter Tarchin zum Zusammenbruch von Gesellschaften.
Bericht zu den Digital Humanities: Mit Data-Minging die Geisteswissenschaften umpflügen.
Bericht zu den Digital Humanities: Mit Data-Minging die Geisteswissenschaften umpflügen.
Zur Universalität von Zipf's Gesetz (als Ergebnis eines Teilungsprozesses).
Zur Universalität von Zipf's Gesetz (als Ergebnis eines Teilungsprozesses).
Ein eher kritischer Blick auf das ETH-Flagship FuturICT: die Vision der Kybernetik wird wachgeküsst.
Ein eher kritischer Blick auf das ETH-Flagship FuturICT: die Vision der Kybernetik wird wachgeküsst.
Computergestützte Sozialwissenschaften sollen Kriege erklär- und gewinnbar machen.
Computergestützte Sozialwissenschaften sollen Kriege erklär- und gewinnbar machen.
Beispiel einer funktionierenden "wisdom of crowds": Fischschwärme.
Beispiel einer funktionierenden "wisdom of crowds": Fischschwärme.
Eine Zusammenstellung der so genannten 10 wichtigsten Fragestellungen der Sozialwissenschaften (keine sehr inspirierende Liste).
Eine Zusammenstellung der so genannten 10 wichtigsten Fragestellungen der Sozialwissenschaften (keine sehr inspirierende Liste).
Ein Paper zur "politischen Komplexität" in Aborignies-Gesellschaften (Grade der gesellschaftlichen Organisation).
Ein Paper zur "politischen Komplexität" in Aborignies-Gesellschaften (Grade der gesellschaftlichen Organisation).
Ausformulierung der These, dass die Welt zu komplex ist, um sie zu verstehen (und was die Folgerungen daraus sind).
Ausformulierung der These, dass die Welt zu komplex ist, um sie zu verstehen (und was die Folgerungen daraus sind).
Wie man Optoelektronik Nutzen kann, um Chaos und nichtlineare Effekte zu studieren.
Wie man Optoelektronik Nutzen kann, um Chaos und nichtlineare Effekte zu studieren.
Zum Aufbau grosser Datenbanken mit Krebs-Genen.
Zum Aufbau grosser Datenbanken mit Krebs-Genen.
Beispiel einer Studie zur (fehlenden) Robustheit komplexer Netzwerke.
Beispiel einer Studie zur (fehlenden) Robustheit komplexer Netzwerke.
Ein grosser Artikel zur Komplexität biologischer Systeme (desto genauer die Biologen hinschauen, desto Komplexer wird die Sache). Zudem ein Artikel der zeigt, dass es offenbar doch keinen universellen Scaling-Exponenten zwischen…
Ein grosser Artikel zur Komplexität biologischer Systeme (desto genauer die Biologen hinschauen, desto Komplexer wird die Sache). Zudem ein Artikel der zeigt, dass es offenbar doch keinen universellen Scaling-Exponenten zwischen Körpergrösse und Metabolismus von Tieren gibt.
Ein Modell, das gewisse statistische Eigenschaften (Timing und Opferzahl von Anschlägen) moderner Guerilliakriege erklären will (u.a. eine Funktion der gewünschten medialen Aufmerksamkeit - wäre dann keine Berichterstattung eine Gegenstrategie?).
Ein Modell, das gewisse statistische Eigenschaften (Timing und Opferzahl von Anschlägen) moderner Guerilliakriege erklären will (u.a. eine Funktion der gewünschten medialen Aufmerksamkeit - wäre dann keine Berichterstattung eine Gegenstrategie?).
Sehr interessant: wie man das Verhalten von Fliegen automatisiert kodieren kann; dürfte auch wichtig für maschine vision werden.
Sehr interessant: wie man das Verhalten von Fliegen automatisiert kodieren kann; dürfte auch wichtig für maschine vision werden.
Einige grundsätzliche Überlegungen zur Nutzung der Schwarm-Metaphorik (ausgehend von der System-/Komplexitätsforschung) zur Erklärung gesellschaftlicher Prozesse: Verlust des Individuums.
Einige grundsätzliche Überlegungen zur Nutzung der Schwarm-Metaphorik (ausgehend von der System-/Komplexitätsforschung) zur Erklärung gesellschaftlicher Prozesse: Verlust des Individuums.
Wie man Forschungen zum Schwarmverhalten von Fischen nutzen kann um zu verstehen, wie man grosse Menschenmassen bewegen kann (Schwarmeffekte).
Wie man Forschungen zum Schwarmverhalten von Fischen nutzen kann um zu verstehen, wie man grosse Menschenmassen bewegen kann (Schwarmeffekte).
Sehr interessanter Review zur Frage, wie man Anzeichen von regime-shifts (bzw. kritische Punkte) in komplexen Systemen finden kann.
Sehr interessanter Review zur Frage, wie man Anzeichen von regime-shifts (bzw. kritische Punkte) in komplexen Systemen finden kann.
Gleich mehrere Artikel über die Rolle von agent-based modelling in den Sozialwissenschaften, Medizin und Ökonomie (Krisen und Pandemien voraussagen, Dirk wird zitiert).
Gleich mehrere Artikel über die Rolle von agent-based modelling in den Sozialwissenschaften, Medizin und Ökonomie (Krisen und Pandemien voraussagen, Dirk wird zitiert).
Bericht über die Konferenz von Dirk zur Nutzung von Modellierung und complex systems approaches in den Sozialwissenschaften.
Bericht über die Konferenz von Dirk zur Nutzung von Modellierung und complex systems approaches in den Sozialwissenschaften.
Spinsysteme haben die Eigenschaft, unentscheidbar zu sein (im Sinne von Gödel) - ein interessnater Punkt in der Debatte um die Reichweite reduktionistischer Erklärungen in der Physik.
Spinsysteme haben die Eigenschaft, unentscheidbar zu sein (im Sinne von Gödel) - ein interessnater Punkt in der Debatte um die Reichweite reduktionistischer Erklärungen in der Physik.
Mehrere interessante Artikel: Der nested mutualism in komplexen Netzwerken vermindert competition und erhöht die Zahl der möglichen Player im Netzwerk (z.B. Biodiversität) - erhöht aber auch das Risiko von grossen…
Mehrere interessante Artikel: Der nested mutualism in komplexen Netzwerken vermindert competition und erhöht die Zahl der möglichen Player im Netzwerk (z.B. Biodiversität) - erhöht aber auch das Risiko von grossen Zusammenbrüchen, wenn die dicht vernetzten Player verschwinden. Ein zweiter Artikel beschreibt die Nutzung von Handy-Daten für die Ermittlung komplexer Interaktionsmuster.
Eine vertiefende, spieltheoretische Analyse des "costly punishment". Sollte mich interessieren.
Eine vertiefende, spieltheoretische Analyse des "costly punishment". Sollte mich interessieren.
Beispiel der Nutzung der Erforschung sozialer Netzwerke (anhand online-datenbanken): Erfolgreiche Muster von Kollaborationen in der Wissenschaft (interessant!).
Beispiel der Nutzung der Erforschung sozialer Netzwerke (anhand online-datenbanken): Erfolgreiche Muster von Kollaborationen in der Wissenschaft (interessant!).
Man soll die komplexen Informationsflüsse in Lebewesen besser verstehen - d.h. das kybernetische Bild wird reaktiviert.
Man soll die komplexen Informationsflüsse in Lebewesen besser verstehen - d.h. das kybernetische Bild wird reaktiviert.
Man kann (und soll) auch geschichtliche Prozesse simulieren, um deren Dynamik zu erfassen.
Man kann (und soll) auch geschichtliche Prozesse simulieren, um deren Dynamik zu erfassen.
Wie man die hierarchischen Strukturen in Netzwerken finden kann und was man daraus lesen kann.
Wie man die hierarchischen Strukturen in Netzwerken finden kann und was man daraus lesen kann.
Ein uniformer Blick auf Netzwerke (Gene, Sprache) aus der Perspektive des Informationsaustauschs.
Ein uniformer Blick auf Netzwerke (Gene, Sprache) aus der Perspektive des Informationsaustauschs.
Rückblick auf 40 Jahre Operations Research an der ETH Zürich.
Rückblick auf 40 Jahre Operations Research an der ETH Zürich.
Neue linguistische Studien zum Verhältnis Sprachveränderung und Kulturveränderung (methodisch interessant).
Neue linguistische Studien zum Verhältnis Sprachveränderung und Kulturveränderung (methodisch interessant).
Wie mittels statistisch gestützter Analyse Literatur neu untersucht und bewertet wird.
Wie mittels statistisch gestützter Analyse Literatur neu untersucht und bewertet wird.
Zum Verhältnis von Zufall und Determinismus.
Zum Verhältnis von Zufall und Determinismus.
Wie man mittels statistischer Modelle einen "freien Willen" bei Fliegen finden will (als eine Form von Chaos - mal genauer anschauen).
Wie man mittels statistischer Modelle einen "freien Willen" bei Fliegen finden will (als eine Form von Chaos - mal genauer anschauen).
Zum Begriff der Optimalität bei Netzwerken.
Zum Begriff der Optimalität bei Netzwerken.
Zu den Protokollen, welche den Aufbau von Organismen steuern: sie machen diese robust, aber auch anfällig für bestimmte, seltene Perturbationen.
Zu den Protokollen, welche den Aufbau von Organismen steuern: sie machen diese robust, aber auch anfällig für bestimmte, seltene Perturbationen.
Die Studie über zahlreiche Faktoren, welche die Dynamik von Städten bestimmen. energie etc. weisen eine economy of scale auf, Innovation hingegen beschleunigt das soziale Leben der Städte (ganz interessante Geschichte).
Die Studie über zahlreiche Faktoren, welche die Dynamik von Städten bestimmen. energie etc. weisen eine economy of scale auf, Innovation hingegen beschleunigt das soziale Leben der Städte (ganz interessante Geschichte).
Was man mit einheitlichen Prinzipien der Organisation von Netzwerken meinen kann.
Was man mit einheitlichen Prinzipien der Organisation von Netzwerken meinen kann.
Zu den Vorgängen zwischen der Nano- und der Mikroskala - ein Ort, wo Biologie und Physik zusammentreffen.
Zu den Vorgängen zwischen der Nano- und der Mikroskala - ein Ort, wo Biologie und Physik zusammentreffen.
Wie man nichthierarchische Systeme kontrollieren kann.
Wie man nichthierarchische Systeme kontrollieren kann.
Essay zur Frage, dass Kollektive so genannte higher-order computation machen können - das müsste man aber besser definieren.
Essay zur Frage, dass Kollektive so genannte higher-order computation machen können - das müsste man aber besser definieren.
Fox Keller zu den Kulturunterschieden zwischen Physik und Biologie angesichts komplexer Systeme.
Fox Keller zu den Kulturunterschieden zwischen Physik und Biologie angesichts komplexer Systeme.
Ein Simulations-Grossprojekt: ein Modell von Grossbritannien.
Ein Simulations-Grossprojekt: ein Modell von Grossbritannien.
Warum die Simulationsforschung in den kommenden Jahren immer wichtiger werden wird.
Warum die Simulationsforschung in den kommenden Jahren immer wichtiger werden wird.
Zum Stand des Wissens im Bereich der (praktischen) Chaosforschung.
Zum Stand des Wissens im Bereich der (praktischen) Chaosforschung.
Zur Problematik der Kausalität in hierarchischen Strukturen – einer möglichen definitorischen Eigenschaft von Komplexität.
Zur Problematik der Kausalität in hierarchischen Strukturen – einer möglichen definitorischen Eigenschaft von Komplexität.
Zur Bedeutung der Ergodizität – einem zentralen Konzept der statistischen Physik.
Zur Bedeutung der Ergodizität – einem zentralen Konzept der statistischen Physik.
Zur Geschichte der Herstellung von Zufallszahlen.
Zur Geschichte der Herstellung von Zufallszahlen.
Zu den verschiedenen Skalengesetzen in der Biologie.
Zu den verschiedenen Skalengesetzen in der Biologie.
Blick auf die Soziophysik: die Untersuchung sozialer Systeme mit Mitteln der Physik.
Blick auf die Soziophysik: die Untersuchung sozialer Systeme mit Mitteln der Physik.
Präsentation eines Geräts, das Zufallszahlen mit einem Quantenprozess erzeugen kann.
Präsentation eines Geräts, das Zufallszahlen mit einem Quantenprozess erzeugen kann.
Zur Bedeutung des Konzepts der seltsamen Attraktoren – gezeigt am Beispiel des Lorenz-Attraktors.
Zur Bedeutung des Konzepts der seltsamen Attraktoren – gezeigt am Beispiel des Lorenz-Attraktors.
Zum Einsatz mathematischer Netzwerk-Theorien für die Erklärung biologischer Phänomene.
Zum Einsatz mathematischer Netzwerk-Theorien für die Erklärung biologischer Phänomene.
Ein Blick auf die Praxis komplexer Systeme: man sollte grosse technische Systeme so auffassen und versuchen zu verstehen, was hier Emergenz bedeutet.
Ein Blick auf die Praxis komplexer Systeme: man sollte grosse technische Systeme so auffassen und versuchen zu verstehen, was hier Emergenz bedeutet.
Wie die Schwarmbildung von Fischen als Prozess der Selbstorganisation verstanden werden kann.
Wie die Schwarmbildung von Fischen als Prozess der Selbstorganisation verstanden werden kann.
Wie man Evolution simulieren kann am Beispiel der Forschung des Labors für künstliche Intelligenz der Universität Zürich.
Wie man Evolution simulieren kann am Beispiel der Forschung des Labors für künstliche Intelligenz der Universität Zürich.
Zum Konzept der Synchronizität, das in verschiedenen Anwendungsbereichen bedeutsam werden kann.
Zum Konzept der Synchronizität, das in verschiedenen Anwendungsbereichen bedeutsam werden kann.
Zum praktischen Einsatz von zellulären Automaten mittels eines speziell dafür geschriebenen Computerprogramms.
Zum praktischen Einsatz von zellulären Automaten mittels eines speziell dafür geschriebenen Computerprogramms.
Ein recht umfassender Blick auf die aktuelle Komplexitätsforschung.
Ein recht umfassender Blick auf die aktuelle Komplexitätsforschung.
Zum Begriff der Vorhersage bzw. Voraussage von Systemverhalten.
Zum Begriff der Vorhersage bzw. Voraussage von Systemverhalten.
Wie man mit zellulären Automaten den Strassenverkehr voraussagen kann.
Wie man mit zellulären Automaten den Strassenverkehr voraussagen kann.
Rezensionen über zwei Bücher zur Theorie der Netzwerke. Dazu ein Essay über die Bedeutung der Komplexitätswissenschaft.
Rezensionen über zwei Bücher zur Theorie der Netzwerke. Dazu ein Essay über die Bedeutung der Komplexitätswissenschaft.
Kritische Rezension des Buchs von Wolfram. Dazu ein weiterer Kommentar.
Kritische Rezension des Buchs von Wolfram. Dazu ein weiterer Kommentar.
Bericht über das Buch von Wolfram, der die Welt mit zellulären Automaten beschreiben will.
Bericht über das Buch von Wolfram, der die Welt mit zellulären Automaten beschreiben will.
Zum Einsatz von Supercomputern in der Simulation – hier am Beispiel der Atomdynamik gezeigt.
Zum Einsatz von Supercomputern in der Simulation – hier am Beispiel der Atomdynamik gezeigt.
Nun ist endgültig bewiesen worden, dass der Lorenz-Attraktor eine fraktale Struktur hat.
Nun ist endgültig bewiesen worden, dass der Lorenz-Attraktor eine fraktale Struktur hat.
Zum Einsatz der Simulationsforschung im bereich sozialer Systeme – z.B. in der Panikforschung.
Zum Einsatz der Simulationsforschung im bereich sozialer Systeme – z.B. in der Panikforschung.
Wie man sich vom Immunsystem inspirieren lassen kann, um neue Formen der Steuerung von Robotern zu gewinnen oder auch für die Abwehr im Bereich IT-Security.
Wie man sich vom Immunsystem inspirieren lassen kann, um neue Formen der Steuerung von Robotern zu gewinnen oder auch für die Abwehr im Bereich IT-Security.
Ein Projekt der ETH-Lausanne: eine Art Simulation des Lebens (oder doch nur Show?).
Ein Projekt der ETH-Lausanne: eine Art Simulation des Lebens (oder doch nur Show?).
Zur Anwendung der Physik auf soziale Systeme.
Zur Anwendung der Physik auf soziale Systeme.
Wie man die Spieltheorie auf der Ebene der Quantentheorie anwenden kann.
Wie man die Spieltheorie auf der Ebene der Quantentheorie anwenden kann.
Ist das Auftreten der Ziffern in der Zahl Pi zufällig – oder kann man mittels der Chaostheorie doch eine Form von Regelmässigkeit entdecken?
Ist das Auftreten der Ziffern in der Zahl Pi zufällig – oder kann man mittels der Chaostheorie doch eine Form von Regelmässigkeit entdecken?
Wie Skalengesetze Teil einer biologischen Theorie für Alles sein können.
Wie Skalengesetze Teil einer biologischen Theorie für Alles sein können.
Zum Quantenchaos und dem Unterschied zum klassischen Chaos.
Zum Quantenchaos und dem Unterschied zum klassischen Chaos.
Zur Physik des Rauschens und der random walks.
Zur Physik des Rauschens und der random walks.
Wie man thermische Fluktuationen in eine gerichtete Bewegung bringen kann – Beispiel einer stochastischen Resonanz.
Wie man thermische Fluktuationen in eine gerichtete Bewegung bringen kann – Beispiel einer stochastischen Resonanz.
Eine Sammlung von Reviews zur Theorie komplexer Systeme: Rauschen, Ordnung, Phasenübergänge, komplexe Netzwerke und Synchronisierung.
Eine Sammlung von Reviews zur Theorie komplexer Systeme: Rauschen, Ordnung, Phasenübergänge, komplexe Netzwerke und Synchronisierung.
was ist eigentlich ein „Muster“? Hier einige Gedanken dazu.
was ist eigentlich ein „Muster“? Hier einige Gedanken dazu.
Ein Blick auf das Konzept der stochastischen Resonanz – vorab im Kontext der Sinneswahrnehmung.
Ein Blick auf das Konzept der stochastischen Resonanz – vorab im Kontext der Sinneswahrnehmung.
Ein Blick auf das so genannte raumzeitliche Chaos – ein aktuelles Forschungsgebiet im Bereich der nichtlinearen Systeme.
Ein Blick auf das so genannte raumzeitliche Chaos – ein aktuelles Forschungsgebiet im Bereich der nichtlinearen Systeme.
Zu den Skalengesetzen zwischen Körpermasse und metabolischem Umsatz bei Organismen.
Zu den Skalengesetzen zwischen Körpermasse und metabolischem Umsatz bei Organismen.
Zur Bedeutung des Ising-Modells für die Erklärung verschiedenster Vorgänge in der realen Welt als Ergebnis lokaler Interaktionen.
Zur Bedeutung des Ising-Modells für die Erklärung verschiedenster Vorgänge in der realen Welt als Ergebnis lokaler Interaktionen.
Die Bedeutung der stochastischen Resonanz – beispielsweise bei biologischen Sensoren.
Die Bedeutung der stochastischen Resonanz – beispielsweise bei biologischen Sensoren.
Rechenkomplexität kann auch mit Methoden der statistischen Physik untersucht werden.
Rechenkomplexität kann auch mit Methoden der statistischen Physik untersucht werden.
Bericht über eine Konferenz über „künstliches Leben“.
Bericht über eine Konferenz über „künstliches Leben“.
Zum Zusammenhang von Zufall und der Theorie der Berechnungskomplexität.
Zum Zusammenhang von Zufall und der Theorie der Berechnungskomplexität.
Ein Blick auf das Problem der Berechnungskomplexität.
Ein Blick auf das Problem der Berechnungskomplexität.
Ein Beispiel wie die Spieltheorie praktische Anwendung finden kann: die Interaktion von Bakteriophagen.
Ein Beispiel wie die Spieltheorie praktische Anwendung finden kann: die Interaktion von Bakteriophagen.
Wie sich künstliches Leben für Computerspiele nutzen lässt.
Wie sich künstliches Leben für Computerspiele nutzen lässt.
Die USA wollen in den kommenden Jahren 200 Millionen Dollar für die Förderung der Simulationsforschung stecken.
Die USA wollen in den kommenden Jahren 200 Millionen Dollar für die Förderung der Simulationsforschung stecken.
Zum Begriff der Emergenz.
Zum Begriff der Emergenz.
Zu den verschiedenen Moden der Vibration – erklärt mit einem nichtlinearen Modell.
Zu den verschiedenen Moden der Vibration – erklärt mit einem nichtlinearen Modell.
Zur Bedeutung der Brownschen Bewegung für Chaos im Mikrobereich.
Zur Bedeutung der Brownschen Bewegung für Chaos im Mikrobereich.
Zur den Auswirkungen der Nichtlinearität in Modellen der Ökologie am Beispiel der Fluktuationen von Schafpopulationen.
Zur den Auswirkungen der Nichtlinearität in Modellen der Ökologie am Beispiel der Fluktuationen von Schafpopulationen.