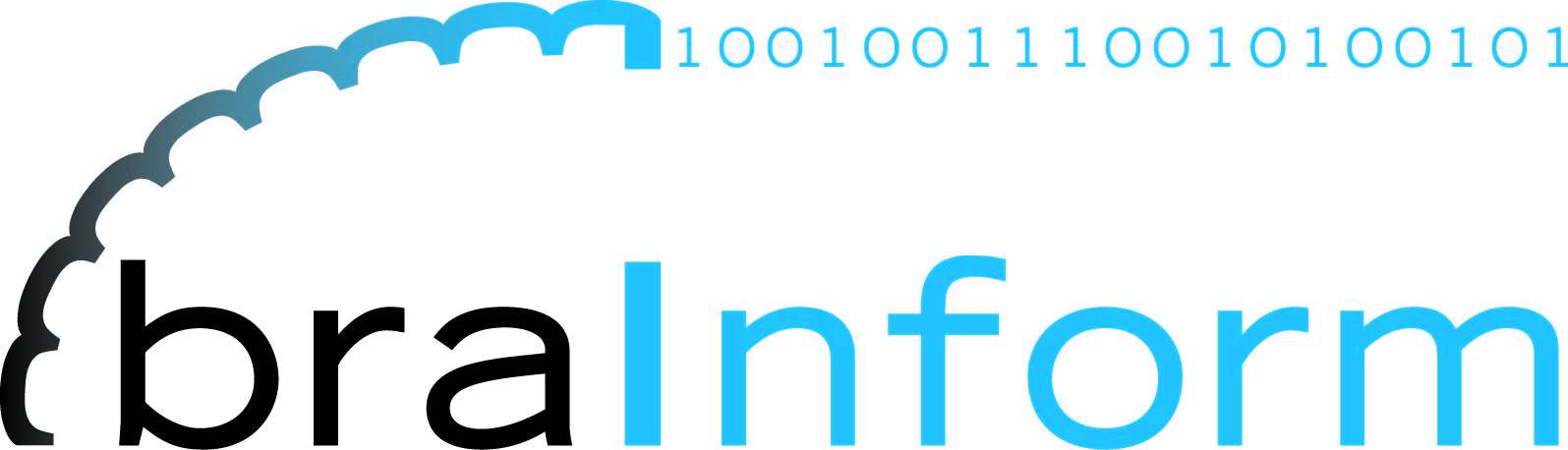Die US-Regierung will das weltweit wichtigste Zentrum der Wetterforschung schliessen (NCAR in Colorado).
Die US-Regierung will das weltweit wichtigste Zentrum der Wetterforschung schliessen (NCAR in Colorado).
Was man heute über den nuklearen Winter denkt.
Was man heute über den nuklearen Winter denkt.
Eine Warnung vor Alarmismus in der Klimaforschung.
Eine Warnung vor Alarmismus in der Klimaforschung.
2024 war das wärmste Jahr seit Messbeginn.
2024 war das wärmste Jahr seit Messbeginn.
Hecken speichern gleich viel CO2 wie Wälder und sind ökologisch vielfältiger
Hecken speichern gleich viel CO2 wie Wälder und sind ökologisch vielfältiger
Zu den neurologischen Auswirkungen des Klimawandels.
Zu den neurologischen Auswirkungen des Klimawandels.
Die Evidenz verdichtet sich, dass der Klimawandel die Stärke der Hurrikane erhöht.
Die Evidenz verdichtet sich, dass der Klimawandel die Stärke der Hurrikane erhöht.
Die Weltmeere sind so warm wie nie und man versteht nicht warum.
Die Weltmeere sind so warm wie nie und man versteht nicht warum.
Wie saubere Luft die Erderwärmung beschleunigt.
Wie saubere Luft die Erderwärmung beschleunigt.
Neue Modelle verweisen auf die Möglichkeit, dass die Tiefenzirkulation imi Atlantik versiegt, was gravierende Auswirkungen auf Nordeuropa hätte.
Neue Modelle verweisen auf die Möglichkeit, dass die Tiefenzirkulation imi Atlantik versiegt, was gravierende Auswirkungen auf Nordeuropa hätte.
Die kritische ETH-Studie beruht bezüglich Berechnungen auf einem Extremszenario (doch so extrem ist es nicht, denn Import wird nicht funktionieren, wenn es systemtisch überall zuwenig Strom im Winter hat).
Die kritische ETH-Studie beruht bezüglich Berechnungen auf einem Extremszenario (doch so extrem ist es nicht, denn Import wird nicht funktionieren, wenn es systemtisch überall zuwenig Strom im Winter hat).
Die These, dass der Klimawandel automatisch und generell zu extremerem Wetter führt, ist falsch.
Die These, dass der Klimawandel automatisch und generell zu extremerem Wetter führt, ist falsch.
Erforschung von Verfahren, um effizient CO2 aus der Atmosphäre zu filtern.
Erforschung von Verfahren, um effizient CO2 aus der Atmosphäre zu filtern.
Die Wissenschaftler von Exxon hatten schon früh präzsise Klinaprognosen, die aber nicht nach Aussen drangen.
Die Wissenschaftler von Exxon hatten schon früh präzsise Klinaprognosen, die aber nicht nach Aussen drangen.
Wie durch den Klimawandel der Energiegehalt des globalen Klimasystems zunimmt.
Wie durch den Klimawandel der Energiegehalt des globalen Klimasystems zunimmt.
Eine Übersicht über Technologien zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre.
Eine Übersicht über Technologien zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre.
Neues zur Erforschung von "Kipppunkten" im Klima.
Neues zur Erforschung von "Kipppunkten" im Klima.
Die Klimamodelle nähern sich immer mehr der Realität an (mit Blick auf die Auflösung).
Die Klimamodelle nähern sich immer mehr der Realität an (mit Blick auf die Auflösung).
War die erste Person, welche den Treibhauseffekt entdeckte, eine Frau?
War die erste Person, welche den Treibhauseffekt entdeckte, eine Frau?
Der Westen der USA wird langfristig verdorren.
Der Westen der USA wird langfristig verdorren.
Statistik der Waldbrände im Mittelmehrraum: diese werden zunehmen.
Statistik der Waldbrände im Mittelmehrraum: diese werden zunehmen.
Wie die Erderwärmung und paradoxerweise der Schnee das Abschmelzen des Eises im Nordatlantik beschleunigt.
Wie die Erderwärmung und paradoxerweise der Schnee das Abschmelzen des Eises im Nordatlantik beschleunigt.
Neuere Forschungen zeigen, dass das Maximum der Warmzeit nicht vor 5-9000 Jahren war, sondern heute (man überschätzte die damaligen Temperaturen aufgrund eines Bias in den Daten).
Neuere Forschungen zeigen, dass das Maximum der Warmzeit nicht vor 5-9000 Jahren war, sondern heute (man überschätzte die damaligen Temperaturen aufgrund eines Bias in den Daten).
Wie man aus historischen Daten das Wetter früherer Zeiten rekonstruieren will.
Wie man aus historischen Daten das Wetter früherer Zeiten rekonstruieren will.
Forschungen zur Eisfreiheit der Alpen während des Klimaoptimums im frühen Holozän.
Forschungen zur Eisfreiheit der Alpen während des Klimaoptimums im frühen Holozän.
Wie man Stahl CO2-frei produzieren kann: Wasserstoff statt Koks als Reduktionsmittel. Derzeit noch etwa 30% teurer.
Wie man Stahl CO2-frei produzieren kann: Wasserstoff statt Koks als Reduktionsmittel. Derzeit noch etwa 30% teurer.
Wie man Beton mit CO2 sättigen will und damit den CO2-Kreislauf der Zementherstellung so gut wie möglich schliessen will (funktioniert aber nicht wirklich, dass Problem ist ja die Wärme, die…
Wie man Beton mit CO2 sättigen will und damit den CO2-Kreislauf der Zementherstellung so gut wie möglich schliessen will (funktioniert aber nicht wirklich, dass Problem ist ja die Wärme, die man bei der Zementherstellung braucht, und nicht das CO2, das dabei freitritt).
Ein Geo-Engineering-Versuch zur Minderung des Klimawandels: die Wirkung von Kalkspat in der Stratosphäre wird untersucht.
Ein Geo-Engineering-Versuch zur Minderung des Klimawandels: die Wirkung von Kalkspat in der Stratosphäre wird untersucht.
Ökonomen berechnen den wirtschaftlich "optimalen" Klimawandel (also das Ziel mit den kostengünstigsten Anpassungen).
Ökonomen berechnen den wirtschaftlich "optimalen" Klimawandel (also das Ziel mit den kostengünstigsten Anpassungen).
Der auftauende Permafrost-Boden wird vermutlich nicht zu einer starken Methankonzentration beitragen - andere Quellen sind wichtiger.
Der auftauende Permafrost-Boden wird vermutlich nicht zu einer starken Methankonzentration beitragen - andere Quellen sind wichtiger.
Die neue Generation der Klimamodelle ist zu sensitiv: geringe Parameteränderungen führen zu grossen Schwankungen. Warum das so ist, ist derzeit unklar.
Die neue Generation der Klimamodelle ist zu sensitiv: geringe Parameteränderungen führen zu grossen Schwankungen. Warum das so ist, ist derzeit unklar.
Warum das CO2-Bindungspotenzial der Aufforstung überschätzt wird.
Warum das CO2-Bindungspotenzial der Aufforstung überschätzt wird.
Wie Klimaforscher den Einfluss der Zahl der Menschen in ihren Modellen berücksichtigen.
Wie Klimaforscher den Einfluss der Zahl der Menschen in ihren Modellen berücksichtigen.
Wie man mit Klima-Modelle extreme Wetterereignisse verstehen will.
Wie man mit Klima-Modelle extreme Wetterereignisse verstehen will.
Die Methan-Konzentration nimmt in den letzten Jahren wieder deutlich zu - und die Forscher grübeln, warum das so ist.
Die Methan-Konzentration nimmt in den letzten Jahren wieder deutlich zu - und die Forscher grübeln, warum das so ist.
Eine Umstellung der Ernährung auf weniger Fleisch hätte nicht in jedem Land einen positiven Effekt auf die CO2-Bilanz und damit aufs Klima.
Eine Umstellung der Ernährung auf weniger Fleisch hätte nicht in jedem Land einen positiven Effekt auf die CO2-Bilanz und damit aufs Klima.
Neue Modellrechnungen sehen ein grösseres Potenzial für CO2-Ausstoss, um das 1.5-Grad-Ziel dennoch nicht zu überschreiten.
Neue Modellrechnungen sehen ein grösseres Potenzial für CO2-Ausstoss, um das 1.5-Grad-Ziel dennoch nicht zu überschreiten.
Ein Fact Sheet zum Klimawandel in der Schweiz und global.
Ein Fact Sheet zum Klimawandel in der Schweiz und global.
Zu den vermuteten Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweiz: Die Sommer werden mediterraner, die Winter weniger schneereich.
Zu den vermuteten Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweiz: Die Sommer werden mediterraner, die Winter weniger schneereich.
Ein neues gigantisches Stück Schelfeis bricht in der Antarktis ab.
Ein neues gigantisches Stück Schelfeis bricht in der Antarktis ab.
Die gängigen Extremszenarien bezüglich CO2-Ausstoss (sowohl minimal wie maximal) sind nun bereits sehr unwahrscheinlich geworden.
Die gängigen Extremszenarien bezüglich CO2-Ausstoss (sowohl minimal wie maximal) sind nun bereits sehr unwahrscheinlich geworden.
Das Massenaussterben am Ende der Perm-Zeit war vermutlich das Ergebnis einer Abkühlung und nicht einer Erwärmung des Klimas.
Das Massenaussterben am Ende der Perm-Zeit war vermutlich das Ergebnis einer Abkühlung und nicht einer Erwärmung des Klimas.
Rückblick auf den Hungersommer von 1816 - eine Kombination klimatischer und gesellschaftlicher Faktoren (an sich nichts neues: je unstabiler die Gesellschaft, desto grösser die Auswirkungen von Klima-Schocks wie damals der…
Rückblick auf den Hungersommer von 1816 - eine Kombination klimatischer und gesellschaftlicher Faktoren (an sich nichts neues: je unstabiler die Gesellschaft, desto grösser die Auswirkungen von Klima-Schocks wie damals der Vulkanausbruch des Tambora).
2015 war das bislang wärmste Jahr seit Beginn der Messungen.
2015 war das bislang wärmste Jahr seit Beginn der Messungen.
Die Atmosphäre soll eine gewisse Selbstregulation haben: Mehr Wärme führt zu weniger breiten Wolken und damit zu mehr Wärmeabstrahlung in der Nacht.
Die Atmosphäre soll eine gewisse Selbstregulation haben: Mehr Wärme führt zu weniger breiten Wolken und damit zu mehr Wärmeabstrahlung in der Nacht.
Die These, wonach Klimawandel konflikte fördern würde, ist empirisch offenbar nicht belegt.
Die These, wonach Klimawandel konflikte fördern würde, ist empirisch offenbar nicht belegt.
Bericht zur Erforschung von Geo-Engineering Massnahmen zur Verminderung des Klimawandels.
Bericht zur Erforschung von Geo-Engineering Massnahmen zur Verminderung des Klimawandels.
Ein neuer, bislang zu wenig beachteter Klima-Mechanismus: chemische Rückkopplungen in der Atmosphäre. Diese wirken gegen die globale Erwärmung.
Ein neuer, bislang zu wenig beachteter Klima-Mechanismus: chemische Rückkopplungen in der Atmosphäre. Diese wirken gegen die globale Erwärmung.
Die Erforschung der wirtschaftlichen Folgen von El Ninjo.
Die Erforschung der wirtschaftlichen Folgen von El Ninjo.
Interview mit Stocker, der nun von seiner Rolle im Leitungsgremium der IPCC abtritt.
Interview mit Stocker, der nun von seiner Rolle im Leitungsgremium der IPCC abtritt.
Philosophen untersuchen (endlich) wissenschaftstheoretische Fragen von Klimasimulationen (an der Uni Bern).
Philosophen untersuchen (endlich) wissenschaftstheoretische Fragen von Klimasimulationen (an der Uni Bern).
Die Klimamodelle können derzeit keine verlässlichen mittelfristigen Prognosen (d.h. für die nächsten paar Jahre) machen.
Die Klimamodelle können derzeit keine verlässlichen mittelfristigen Prognosen (d.h. für die nächsten paar Jahre) machen.
Warum die Bedeutung von Schwefelemmissionen aus dem Ozean (wia Phytoplankton: Wolkenbildung) geringer ist als vermutet.
Warum die Bedeutung von Schwefelemmissionen aus dem Ozean (wia Phytoplankton: Wolkenbildung) geringer ist als vermutet.
Eine Beurteilung der Güte heutiger Klimamodelle.
Eine Beurteilung der Güte heutiger Klimamodelle.
Zur Bedeutung von anderen Klimagasen (nicht CO2) für den Klimawandel
Zur Bedeutung von anderen Klimagasen (nicht CO2) für den Klimawandel
Zur Erforschung so genannte "Kippelemente" im Weltklima.
Zur Erforschung so genannte "Kippelemente" im Weltklima.
Wenn man die Klimamodelle mit extremen Parametern füttert (die aber noch möglich sind) so erhält man plus 12 Grad in der Arktis.
Wenn man die Klimamodelle mit extremen Parametern füttert (die aber noch möglich sind) so erhält man plus 12 Grad in der Arktis.
Zur Erforschung der Frage, warum wärmere Ozeane doch zu kälteren Wintern führen können: Gebirge erzeugen Wellen in Luftströmungen mit hunderten von Kilometern Ausdehnung, die den Wärmetransport beeinflussen - ein bislang…
Zur Erforschung der Frage, warum wärmere Ozeane doch zu kälteren Wintern führen können: Gebirge erzeugen Wellen in Luftströmungen mit hunderten von Kilometern Ausdehnung, die den Wärmetransport beeinflussen - ein bislang vernachlässigter Effekt.
Die Geschichten rund um die "Hockeyschläger-Kurve".
Die Geschichten rund um die "Hockeyschläger-Kurve".
Eine interessante Rekonstruktion der Klimageschichte der letzten 2500 Jahre und deren Korrelation zu geschichtlichen Ereignissen.
Eine interessante Rekonstruktion der Klimageschichte der letzten 2500 Jahre und deren Korrelation zu geschichtlichen Ereignissen.
Wie die NAO das Winterwetter in Europa beeinflusst.
Wie die NAO das Winterwetter in Europa beeinflusst.
Warum der Eisbär trotz Klimawandel überleben kann (wenn gehandelt wird).
Warum der Eisbär trotz Klimawandel überleben kann (wenn gehandelt wird).
Wie man die Auswirkungen des Klimawandels auf die tibetanische Hochebene erforschen will.
Wie man die Auswirkungen des Klimawandels auf die tibetanische Hochebene erforschen will.
Zum Stand der Forschung zu La Nina, dem Gegenpart von El Nino.
Zum Stand der Forschung zu La Nina, dem Gegenpart von El Nino.
Die vor Jahren eingeleiteten Massnahmen zum Schutz der Ozonschicht haben auch einen dämpfenden Effekt auf den Klimaandel. Und eine Warnung vor einer Monotonie der Klimamodelle.
Die vor Jahren eingeleiteten Massnahmen zum Schutz der Ozonschicht haben auch einen dämpfenden Effekt auf den Klimaandel. Und eine Warnung vor einer Monotonie der Klimamodelle.
Einer der wenigen realisierbaren Wege, CO2 aus der Atmosphäre ohne grossen Energieaufwand zu entfernen: Verkohlung von Pflanzen und Einarbeitung der Kohle in die Erde (erhöht auch die Bodenfruchtbarkeit).
Einer der wenigen realisierbaren Wege, CO2 aus der Atmosphäre ohne grossen Energieaufwand zu entfernen: Verkohlung von Pflanzen und Einarbeitung der Kohle in die Erde (erhöht auch die Bodenfruchtbarkeit).
Die Gletscher-Variabilität in den Alpen ist primär eine Folge natürlicher Variabilität, doch der aktuelle Klimawandel könnte diese natürliche Variabilität überlagern.
Die Gletscher-Variabilität in den Alpen ist primär eine Folge natürlicher Variabilität, doch der aktuelle Klimawandel könnte diese natürliche Variabilität überlagern.
Erneute Analyse der Temperaturdaten für die Ozeane ab 1993 zeigen eine Erwärmung, doch es bleiben Unklarheiten in Bezug auf andere Indikatoren.
Erneute Analyse der Temperaturdaten für die Ozeane ab 1993 zeigen eine Erwärmung, doch es bleiben Unklarheiten in Bezug auf andere Indikatoren.
Wie man vorgehen soll, um eine einfache, zuverlässige und allgemein zugängliche Datenbank globaler Temperaturen aufzubauen.
Wie man vorgehen soll, um eine einfache, zuverlässige und allgemein zugängliche Datenbank globaler Temperaturen aufzubauen.
Wie aus organischen Überresten geschlossen werden kann, dass die Alpen bereits früher weitgehend gletscherfrei waren.
Wie aus organischen Überresten geschlossen werden kann, dass die Alpen bereits früher weitgehend gletscherfrei waren.
Zunehmend werden Mehrmonats-Wetterprogrnosen gemacht, die gar nicht schlecht sind (quasi in der Zwischenzone von Klima- und Wetterprognose).
Zunehmend werden Mehrmonats-Wetterprogrnosen gemacht, die gar nicht schlecht sind (quasi in der Zwischenzone von Klima- und Wetterprognose).
Zur neuen Generation an Rechnern für die Klima-Simulation: höhere Komplexität der Modelle heisst nicht unbedingt bessere Voraussagekraft.
Zur neuen Generation an Rechnern für die Klima-Simulation: höhere Komplexität der Modelle heisst nicht unbedingt bessere Voraussagekraft.
Beschreibung eines neuartigen Prozesses zur Generierung plausibler Klima-Szenarien.
Beschreibung eines neuartigen Prozesses zur Generierung plausibler Klima-Szenarien.
Eine Zusammenstellung der wichtigsten offenen Fragen der aktuellen Klimaforschung.
Eine Zusammenstellung der wichtigsten offenen Fragen der aktuellen Klimaforschung.
Ein neues Modell erklärt die Entstehung des Monsumregens: Das tibetanische Plateau spielt offenbar keine so grosse Rolle.
Ein neues Modell erklärt die Entstehung des Monsumregens: Das tibetanische Plateau spielt offenbar keine so grosse Rolle.
Stand der Erforschung der Veränderung des Wasserhaushalts in Gletschergebieten weltweit.
Stand der Erforschung der Veränderung des Wasserhaushalts in Gletschergebieten weltweit.
Warum es falsch ist, weiter die Eisendüngung von Ozeanen zwecks Bremsung des Klimawandels zu erforschen.
Warum es falsch ist, weiter die Eisendüngung von Ozeanen zwecks Bremsung des Klimawandels zu erforschen.
Gemäss einer Rekonstruktion der historischen Sturmdichte erlebte die karibik im 11. Jahrhundert etwa gleichviele Wirbelstürme wie heute.
Gemäss einer Rekonstruktion der historischen Sturmdichte erlebte die karibik im 11. Jahrhundert etwa gleichviele Wirbelstürme wie heute.
Gemäss Simulationen sei das aprupte Ende der Eiszeit vor 14'500 Jahren Ergebnis eines Versiegens des Schmelzwasserzuflusses der nordhemisphärischen Eisschilde (und das nachfolgende Wiedereinsetzen nach Einsetzen des Golfstroms reichte nicht aus,…
Gemäss Simulationen sei das aprupte Ende der Eiszeit vor 14'500 Jahren Ergebnis eines Versiegens des Schmelzwasserzuflusses der nordhemisphärischen Eisschilde (und das nachfolgende Wiedereinsetzen nach Einsetzen des Golfstroms reichte nicht aus, um diesen wieder abzustellen - wäre wohl auch für die heutigen entsprechenden Szenarien eine wichtige Erkenntnis).
Neue Forschungsergebnisse zur Bedeutung der ozeanischen Zirkulation (Warmwassertransport) für die Klimageschichte der letzten 800'000 Jahre.
Neue Forschungsergebnisse zur Bedeutung der ozeanischen Zirkulation (Warmwassertransport) für die Klimageschichte der letzten 800'000 Jahre.
Ein Aspekt, der erst jetzt vermehrt in die Klimamodellierung einbezogen wird: die Rolle von Russ (vermindert Albedo, erhöht Schmelzgeschwindigkeit von Eis).
Ein Aspekt, der erst jetzt vermehrt in die Klimamodellierung einbezogen wird: die Rolle von Russ (vermindert Albedo, erhöht Schmelzgeschwindigkeit von Eis).
Wie der Blick auf die Klimageschichte des Mittelalters verfeinert wird und zahlreiche Extremereignisse offenlegt.
Wie der Blick auf die Klimageschichte des Mittelalters verfeinert wird und zahlreiche Extremereignisse offenlegt.
Ein Zuwischenbericht zu acht Jahren NCCR Climate in Bern.
Ein Zuwischenbericht zu acht Jahren NCCR Climate in Bern.
Warum der schneereiche Winter 2008 kein Hinweis darauf ist, dass der Klimawandel sich abschwäche.
Warum der schneereiche Winter 2008 kein Hinweis darauf ist, dass der Klimawandel sich abschwäche.
Zur Modellierung des Klimawandels basierend auf der Gesamtmenge des ausgestossenen CO2.
Zur Modellierung des Klimawandels basierend auf der Gesamtmenge des ausgestossenen CO2.
Neue Modellanalyse über die CO2-Aufnahme des Nordatlantiks: gewisse Klimasignale, die man als Indikatoren langfristiger Trends ansehen könnte, könnten durchaus auch kurzfristige zyklische Schwankungen sein.
Neue Modellanalyse über die CO2-Aufnahme des Nordatlantiks: gewisse Klimasignale, die man als Indikatoren langfristiger Trends ansehen könnte, könnten durchaus auch kurzfristige zyklische Schwankungen sein.
Wie sich der Zusammenbruch der Landwirtschaft in weiten Teilen der ehemaligen Sowjetunion auf die Egenschaft der Flächen, Kohlenstoffsenken zu sein, ausgewirkt hat.
Wie sich der Zusammenbruch der Landwirtschaft in weiten Teilen der ehemaligen Sowjetunion auf die Egenschaft der Flächen, Kohlenstoffsenken zu sein, ausgewirkt hat.
Zur Entwicklung des Packeis am Nordpol seit 1982. Das Nordpolarmeer dürfte ab 2030 zeitweise Eisfrei sein, was auch ganz neue Schiffartswege eröffnet (der Weg Asien-Europa wird kürzer).
Zur Entwicklung des Packeis am Nordpol seit 1982. Das Nordpolarmeer dürfte ab 2030 zeitweise Eisfrei sein, was auch ganz neue Schiffartswege eröffnet (der Weg Asien-Europa wird kürzer).
Feichter zur Bedeutung der Modelle in der Kliimaforschung: das wissenschaftstheoretische Problem, dass Modelle im strikten Sinn nicht verifizierbar bzw. falsifizierbar sind, bleibt.
Feichter zur Bedeutung der Modelle in der Kliimaforschung: das wissenschaftstheoretische Problem, dass Modelle im strikten Sinn nicht verifizierbar bzw. falsifizierbar sind, bleibt.
Wasserdampf soll den stärksten Treibhauseffekt haben (mehr als CO2) - doch wie genau vergleicht man das (die Variabilität von Wasserdampf in der Luft ist ja weit höher als jene von…
Wasserdampf soll den stärksten Treibhauseffekt haben (mehr als CO2) - doch wie genau vergleicht man das (die Variabilität von Wasserdampf in der Luft ist ja weit höher als jene von CO2, oder?).
Stand der Dinge betr. Erforschung des Zusammenhangs zwischen astronomischen Bahnparametern der Erde und Klimawandel.
Stand der Dinge betr. Erforschung des Zusammenhangs zwischen astronomischen Bahnparametern der Erde und Klimawandel.
Zur Rekonstruktion des Klimas im Holozän: die Modelle bilden Klimaschwankungen auf kürzeren zeitskalen (wenige Jahrzehnte) erst schlecht ab.
Zur Rekonstruktion des Klimas im Holozän: die Modelle bilden Klimaschwankungen auf kürzeren zeitskalen (wenige Jahrzehnte) erst schlecht ab.
Zur Frage, ob es einen fünften IPCC-Bericht wirklich braucht und welche Themen drin sein sollten, damit er neuartig ist.
Zur Frage, ob es einen fünften IPCC-Bericht wirklich braucht und welche Themen drin sein sollten, damit er neuartig ist.
Analyse der Wasserführung des Rheins im 20. Jahrhundert: Hochwasser nehmen zu, nicht aber Niedrigwasser (d.h. nur eine Seite des Spektrums der Extreme - bzw. eine Verschiebung des Schwerpunkts der Verteilung).
Analyse der Wasserführung des Rheins im 20. Jahrhundert: Hochwasser nehmen zu, nicht aber Niedrigwasser (d.h. nur eine Seite des Spektrums der Extreme - bzw. eine Verschiebung des Schwerpunkts der Verteilung).
Das Klimaereignis der jüngeren Dryas nun mit einer noch besseren zeitlichen Auflösung: lokaler Temperaturanstieg von bis zu 10 Grad in wenigen Jahrzehnten.
Das Klimaereignis der jüngeren Dryas nun mit einer noch besseren zeitlichen Auflösung: lokaler Temperaturanstieg von bis zu 10 Grad in wenigen Jahrzehnten.
Klimaforschung (bzw. Wetterforschung) auf Chinesisch: wie man Regen machen kann und das Wetter sonstwie manipulieren kann.
Klimaforschung (bzw. Wetterforschung) auf Chinesisch: wie man Regen machen kann und das Wetter sonstwie manipulieren kann.
Die Nature-Studie zum Messfehler der Wassertemperatur nun auch in der NZZ.
Die Nature-Studie zum Messfehler der Wassertemperatur nun auch in der NZZ.
Zur Problematik der Messung von Temperaturveränderungen: Eine Abkühlung in den 1940ern erweist sich als Artefakt. Zudem ein Histogram mit der Zahl von Temperaturmessungen und der geografischen Herkunft ihrer Durchführer.
Zur Problematik der Messung von Temperaturveränderungen: Eine Abkühlung in den 1940ern erweist sich als Artefakt. Zudem ein Histogram mit der Zahl von Temperaturmessungen und der geografischen Herkunft ihrer Durchführer.
Auswertung des Eisbohrkern-Klimaarchivs der Antarktik: Genaueres zu den letzten 800'000 Jahren
Auswertung des Eisbohrkern-Klimaarchivs der Antarktik: Genaueres zu den letzten 800'000 Jahren
Zur Frage, wie man die kurzzeitigen Zyklen (Periode höchstens Jahre) in der Klimaentwicklung prognostizieren kann.
Zur Frage, wie man die kurzzeitigen Zyklen (Periode höchstens Jahre) in der Klimaentwicklung prognostizieren kann.
Zum Zusammenspiel Erosion und Klimawandel in den Alpen: das Beispiel Urserntal.
Zum Zusammenspiel Erosion und Klimawandel in den Alpen: das Beispiel Urserntal.
Beurteilung der Frage, ob der grönländische eisschild schmilzt.
Beurteilung der Frage, ob der grönländische eisschild schmilzt.
Zu den Kohlenwasserstoff-Emissionen, die aus den Wäldern komen (und das ist mehr als aus dem strassenverkehr): doch die Auswirkungen sind weniger gravierend als man bisher dachte.
Zu den Kohlenwasserstoff-Emissionen, die aus den Wäldern komen (und das ist mehr als aus dem strassenverkehr): doch die Auswirkungen sind weniger gravierend als man bisher dachte.
Ein wichtiges Klimaarchiv für das Verständnis der Klimaschwankungen in Asien (insb. Monsunzyklen): Ablagerungen in Höhlen in China (bis 200'000 Jahre zurück).
Ein wichtiges Klimaarchiv für das Verständnis der Klimaschwankungen in Asien (insb. Monsunzyklen): Ablagerungen in Höhlen in China (bis 200'000 Jahre zurück).
Zur Forschung an der snowball-earth-These: so sicher ist man sich nicht mehr.
Zur Forschung an der snowball-earth-These: so sicher ist man sich nicht mehr.
Übersicht über das Wissen der Klimageschichte der letzten 34 Millionen Jahre (insbesondere Eiszeiten).
Übersicht über das Wissen der Klimageschichte der letzten 34 Millionen Jahre (insbesondere Eiszeiten).
Forschungen zum Zusammenhang Klimawandel und kriegerische Ereignisse in den letzten 500 Jahren. Messvariablen waren Lebensmittelpreise, Populationsgrösse und Konflikte (es zeigt sich die erwartete Korrelation).
Forschungen zum Zusammenhang Klimawandel und kriegerische Ereignisse in den letzten 500 Jahren. Messvariablen waren Lebensmittelpreise, Populationsgrösse und Konflikte (es zeigt sich die erwartete Korrelation).
Ein Insiderbericht über die Arbeitsweise des IPCC.
Ein Insiderbericht über die Arbeitsweise des IPCC.
Forschungen über den Stickstoffkreislauf (vorab Ozeane) inkl. Schema.
Forschungen über den Stickstoffkreislauf (vorab Ozeane) inkl. Schema.
Ein detaillierter Blick auf die Klimageschichte der letzten 420'00 Jahre basierend auf Eisbohrkernen.
Ein detaillierter Blick auf die Klimageschichte der letzten 420'00 Jahre basierend auf Eisbohrkernen.
Neuere Forschungen rühren Zweifel an der These, dass die Zunahme von Hurrikanen eine automatische Folge des Klimawandels sei.
Neuere Forschungen rühren Zweifel an der These, dass die Zunahme von Hurrikanen eine automatische Folge des Klimawandels sei.
Zur Rolle der Ozeane für das Verständnis des Klimas.
Zur Rolle der Ozeane für das Verständnis des Klimas.
Zur Simulation von Meeresströmungen und deren Bedeutung für das Verständnis des Klimas.
Zur Simulation von Meeresströmungen und deren Bedeutung für das Verständnis des Klimas.
Eine umfassende Übersicht über die Temperaturschwankungen in der Erdgeschichte (sehr gut).
Eine umfassende Übersicht über die Temperaturschwankungen in der Erdgeschichte (sehr gut).
Zu den Klimaschwankungen, welche die Eiszeiten begleitet haben.
Zu den Klimaschwankungen, welche die Eiszeiten begleitet haben.
Resultate, die der snowball-earth-These widersprechen.
Resultate, die der snowball-earth-These widersprechen.
Zwei Berichte über die Klimaforschung in den Polen: Erforschung der antarktischen Eisschilde und Einfluss des Klimawandels auf Flora und Fauna der Arktis.
Zwei Berichte über die Klimaforschung in den Polen: Erforschung der antarktischen Eisschilde und Einfluss des Klimawandels auf Flora und Fauna der Arktis.
Offenbar können die Ozeane mehr CO2 speichern als bisher gedacht - nur wird das Wasser dadurch saurer.
Offenbar können die Ozeane mehr CO2 speichern als bisher gedacht - nur wird das Wasser dadurch saurer.
Zur Erforschung der Häufigkeit trockener Winter in den letzten 500 Jahren. Der Winter von 2005/06 war kein "Spezialfall".
Zur Erforschung der Häufigkeit trockener Winter in den letzten 500 Jahren. Der Winter von 2005/06 war kein "Spezialfall".
Übersicht über den Stand des Wissens betreffend dem Treibhausgas Methan. Offenbar bestehen betreffend den Quellen und Senken von Methan noch grosse Unsicherheiten, die teilweise von den IPCC-Berichten kaum berücksichtigt wurden.
Übersicht über den Stand des Wissens betreffend dem Treibhausgas Methan. Offenbar bestehen betreffend den Quellen und Senken von Methan noch grosse Unsicherheiten, die teilweise von den IPCC-Berichten kaum berücksichtigt wurden.
Das 14. jahrhundert zeichnet sich durch hohe Klima-Variabilität aus. Warum ist noch unklar.
Das 14. jahrhundert zeichnet sich durch hohe Klima-Variabilität aus. Warum ist noch unklar.
Neue Studien warnen vor einer Unterschätzung des Anstiegs der Meeresspiegel aufgrund der Klimaerwärmung.
Neue Studien warnen vor einer Unterschätzung des Anstiegs der Meeresspiegel aufgrund der Klimaerwärmung.
Wasserkraftwerke überschwemmen grosse Gebiete und erzeugen durch das Absterben des organischen Materials weit mehr Methan und damit Treibhausgase als bisher vermutet. Die globalen Emissionszahlen müssten um ein Fünftel erhöht werden.
Wasserkraftwerke überschwemmen grosse Gebiete und erzeugen durch das Absterben des organischen Materials weit mehr Methan und damit Treibhausgase als bisher vermutet. Die globalen Emissionszahlen müssten um ein Fünftel erhöht werden.
Weitere Hinweise zur Kopplung der nördlichen und südlichen Hemisphäre: eine Nord-Süd-Klimaschaukel, wonach sich die Antarktis erwärmt, wenn es in Grönland kalt ist und umgekehrt.
Weitere Hinweise zur Kopplung der nördlichen und südlichen Hemisphäre: eine Nord-Süd-Klimaschaukel, wonach sich die Antarktis erwärmt, wenn es in Grönland kalt ist und umgekehrt.
Zum Stand der Diskussion betreffend des Einflusses der Sonne auf das Klima und wie man das Problem experimentell angehen könnte.
Zum Stand der Diskussion betreffend des Einflusses der Sonne auf das Klima und wie man das Problem experimentell angehen könnte.
In sehr warmen Jahren kühlen die Ozeane offenbar ab - wegen der Wolkenbildung.
In sehr warmen Jahren kühlen die Ozeane offenbar ab - wegen der Wolkenbildung.
Zur Methanproduktion von Pflanzen - offenbar eine wichtige Komponente im Klimageschehen, die erst langsam erforscht wird.
Zur Methanproduktion von Pflanzen - offenbar eine wichtige Komponente im Klimageschehen, die erst langsam erforscht wird.
Quallenähnliche Tiere spielen eine wichtige Rolle im CO2-Kreislauf.
Quallenähnliche Tiere spielen eine wichtige Rolle im CO2-Kreislauf.
Bericht über neue Forschungen in der Arktis, welche Auskunft über das dort herrschende Klima der letzten 60 Millionen Jahre geben.
Bericht über neue Forschungen in der Arktis, welche Auskunft über das dort herrschende Klima der letzten 60 Millionen Jahre geben.
Zur Bedeutung der Frischwasserzufuhr in die Ozeane, das das Pflanzenwachstum im Ozean und damit auch die CO2-Bindung erhöht.
Zur Bedeutung der Frischwasserzufuhr in die Ozeane, das das Pflanzenwachstum im Ozean und damit auch die CO2-Bindung erhöht.
Höhere Temperaturen führen vermutlich nicht zu einer höheren Rate an Naturgefahren, wird hier mit Blick auf die Klimageschichte und Geologie behauptet.
Höhere Temperaturen führen vermutlich nicht zu einer höheren Rate an Naturgefahren, wird hier mit Blick auf die Klimageschichte und Geologie behauptet.
Offenbar emittieren tropische Wälder grössere Mengen von Methan - was sich auch auf die klimapolitischen Bilanzierungen von Treibhausgasen auswirken dürfte. Zusammen mit der Verrottung stammen 10 bis 30 Prozent des…
Offenbar emittieren tropische Wälder grössere Mengen von Methan - was sich auch auf die klimapolitischen Bilanzierungen von Treibhausgasen auswirken dürfte. Zusammen mit der Verrottung stammen 10 bis 30 Prozent des Methans von Pflanzen.
Zur Beobachtung der Strömungsverhältnisse im Nordatlantik im Hinblick auf die Gefahr einer abrupten Klimaänderung.
Zur Beobachtung der Strömungsverhältnisse im Nordatlantik im Hinblick auf die Gefahr einer abrupten Klimaänderung.
Sibirien absorbiert grosse Mengen von CO2 - setzt es aber auch wieder frei: Die grossen Feuer von 2003 emittierten so viel CO2, wie die Industriestaaten gemäss Kyoto-Protokoll bis 2012 einsparen…
Sibirien absorbiert grosse Mengen von CO2 - setzt es aber auch wieder frei: Die grossen Feuer von 2003 emittierten so viel CO2, wie die Industriestaaten gemäss Kyoto-Protokoll bis 2012 einsparen wollen.
Wie stark ist die derzeitige Klimaveränderung im Vergleich zur früheren Variabilität? Diese Frage ist weit schwerer zu beantworten als man bisher dachte.
Wie stark ist die derzeitige Klimaveränderung im Vergleich zur früheren Variabilität? Diese Frage ist weit schwerer zu beantworten als man bisher dachte.
Zur Bedeutung des Staubs, der global gesehen vorab aus dem Tschad kommt.
Zur Bedeutung des Staubs, der global gesehen vorab aus dem Tschad kommt.
Die Häufigkeit von Überschwemmungen in den letzten 500 Jahren variierte stark und ein klarer Trend ist trotz Klimaerwärmung derzeit nicht sichtbar.
Die Häufigkeit von Überschwemmungen in den letzten 500 Jahren variierte stark und ein klarer Trend ist trotz Klimaerwärmung derzeit nicht sichtbar.
Hinweise zur These, Klima sei wesentlich durch kosmische Strahlung beeinflusst (via Wolkenbildung). Experimentelle Bestätigungen fehlen aber.
Hinweise zur These, Klima sei wesentlich durch kosmische Strahlung beeinflusst (via Wolkenbildung). Experimentelle Bestätigungen fehlen aber.
Zur Bedeutung der Leistungskraft von Computern für Wetterprognosen.
Zur Bedeutung der Leistungskraft von Computern für Wetterprognosen.
Zu den Ergebnissen der Eisbohrungen in Grönland, welche einen detaillierten Blick auf die Klimageschichte seit der letzten Eiszeit erlauben.
Zu den Ergebnissen der Eisbohrungen in Grönland, welche einen detaillierten Blick auf die Klimageschichte seit der letzten Eiszeit erlauben.
Blick auf die Zeit, als die Alpen eisfrei waren (mutmasslich zur Römerzeit).
Blick auf die Zeit, als die Alpen eisfrei waren (mutmasslich zur Römerzeit).
Basierend auf der Sonnenaktivität der letzten 1000 Jahre wird vermutet, dass die Sonne keinen grossen Einfluss auf die globale Erwärmung habe.
Basierend auf der Sonnenaktivität der letzten 1000 Jahre wird vermutet, dass die Sonne keinen grossen Einfluss auf die globale Erwärmung habe.
Bericht über Klimadaten, die aus Messungen von antarktischen Eisproben gewonnen wurden (bis 740'000 Jahre zurück).
Bericht über Klimadaten, die aus Messungen von antarktischen Eisproben gewonnen wurden (bis 740'000 Jahre zurück).
Die Wirkung der Aerosole auf das Klima ist immer noch unklar - je nach Art der Aerosole haben sie eine aufheizende oder eine kühlende Wirkung.
Die Wirkung der Aerosole auf das Klima ist immer noch unklar - je nach Art der Aerosole haben sie eine aufheizende oder eine kühlende Wirkung.
Effekte von Brandrodungen in der Bronzezeit und Eisenzeit auf das Klima: möglicherweise wurde durch das freigesetzte CO2 ein erneutes Einbrechen der Eiszeit verhindert. Siehe dazu auch Nature vom 12.02.04.
Effekte von Brandrodungen in der Bronzezeit und Eisenzeit auf das Klima: möglicherweise wurde durch das freigesetzte CO2 ein erneutes Einbrechen der Eiszeit verhindert. Siehe dazu auch Nature vom 12.02.04.
Zu den Ursachen der weltweiten Vereisung der Erde vor etwa 760 bis 580 Millionen Jahre: die Karbonatfällung war zu gering (d.h. zu wenig CO2 in der Atmosphäre).
Zu den Ursachen der weltweiten Vereisung der Erde vor etwa 760 bis 580 Millionen Jahre: die Karbonatfällung war zu gering (d.h. zu wenig CO2 in der Atmosphäre).
Diskussion der Frage, wie die mittelalterliche Warmperiode einzuschätzen ist: sie sei kein globales Phänomen. Hingegen war es in der ersten Hälfte der vor 11'000 Jahren begonnenen Warmzeit mutmasslich wärmer als…
Diskussion der Frage, wie die mittelalterliche Warmperiode einzuschätzen ist: sie sei kein globales Phänomen. Hingegen war es in der ersten Hälfte der vor 11'000 Jahren begonnenen Warmzeit mutmasslich wärmer als heute.
Zur kleiinen Eiszeit in den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts - eine neuzeitliche Klimakatastrophe.
Zur kleiinen Eiszeit in den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts - eine neuzeitliche Klimakatastrophe.
Erste Erfahrungen mit dem japanischen Earth Simulator - ein Supercomputer im Dienst der Klimaforschung.
Erste Erfahrungen mit dem japanischen Earth Simulator - ein Supercomputer im Dienst der Klimaforschung.
Die Geschichte des ersten Versuchs, Regen mittels Trockeneis auszulösen.
Die Geschichte des ersten Versuchs, Regen mittels Trockeneis auszulösen.
Zur Bedeutung der Emission von ozeangebundenem Methan für das Klima.
Zur Bedeutung der Emission von ozeangebundenem Methan für das Klima.
Zur Entstehung so genannter Monsterwellen im Ozean.
Zur Entstehung so genannter Monsterwellen im Ozean.
Eine Sammlung von Reviews über Klimaforschung - insbesondere betreffend den Einfluss der Ozeane, die CO2-Konzentration und Aerosole auf das Klima.
Eine Sammlung von Reviews über Klimaforschung - insbesondere betreffend den Einfluss der Ozeane, die CO2-Konzentration und Aerosole auf das Klima.
Eine neue Hypothese, warum die kosmischen Zyklen begonnen haben, Eiszeiten zu triggern: durch die Entstehung des tibetanischen Hochlandes.
Eine neue Hypothese, warum die kosmischen Zyklen begonnen haben, Eiszeiten zu triggern: durch die Entstehung des tibetanischen Hochlandes.
Zum Begriff der Unsicherheit bei der Klimamodellierung.
Zum Begriff der Unsicherheit bei der Klimamodellierung.
Zur Debatte um die snowball earth - die These, es habe einst eine totale Vereisung der Erde gegeben.
Zur Debatte um die snowball earth - die These, es habe einst eine totale Vereisung der Erde gegeben.
Bericht über den japanischen Earth Simulator - einem wichtigen Instrument der Klimaforschung.
Bericht über den japanischen Earth Simulator - einem wichtigen Instrument der Klimaforschung.
Wie die Vernetzung von Archiven über klimatische Veränderungen die Klimaforschung erleichern.
Wie die Vernetzung von Archiven über klimatische Veränderungen die Klimaforschung erleichern.
Nicht nur CO2 ist ein Klimagas, auch Methan, Lachgas, Ozon und gewisse Fluorchlorwasserstoffe sind zu beachten.
Nicht nur CO2 ist ein Klimagas, auch Methan, Lachgas, Ozon und gewisse Fluorchlorwasserstoffe sind zu beachten.
Zu den Modellstudien betreffend einer Zunahmen der Regenfälle in Europa und Asien: diese stossen an die Grenzen der aktuellen Klimamodellierung.
Zu den Modellstudien betreffend einer Zunahmen der Regenfälle in Europa und Asien: diese stossen an die Grenzen der aktuellen Klimamodellierung.
Zum Einfluss so genannter planetarer Wellen - atmosphärische Energiepulse - auf das Klima.
Zum Einfluss so genannter planetarer Wellen - atmosphärische Energiepulse - auf das Klima.
Zur Rolle der stochastischen Resonanz bei plötzlichen Temperaturwechseln während der letzten Eiszeit.
Zur Rolle der stochastischen Resonanz bei plötzlichen Temperaturwechseln während der letzten Eiszeit.
Zur Topographie der Meeresoberfläche und wie damit das Klima beeinflusst wird.
Zur Topographie der Meeresoberfläche und wie damit das Klima beeinflusst wird.
Zum Einfluss der Sonne auf das Klima im Nordatlantik.
Zum Einfluss der Sonne auf das Klima im Nordatlantik.
Seit dem Ende der letzten Eiszeit ist das Klima erstaunlich stabil - das ist keineswegs der Regelfall.
Seit dem Ende der letzten Eiszeit ist das Klima erstaunlich stabil - das ist keineswegs der Regelfall.
Wie der Nordatlantik das Wettergeschehen im Alpenraum beeinflusst.
Wie der Nordatlantik das Wettergeschehen im Alpenraum beeinflusst.
Stand des Wissens über die klimatischen Rückkopplungsmechanismen.
Stand des Wissens über die klimatischen Rückkopplungsmechanismen.
Zu den Möglichkeiten und Grenzen, CO2 in Wäldern zu binden.
Zu den Möglichkeiten und Grenzen, CO2 in Wäldern zu binden.
Offenbar geschieht die Umwälzung der Wassermassen im Nordatlantik rascher als vermutet.
Offenbar geschieht die Umwälzung der Wassermassen im Nordatlantik rascher als vermutet.
Zu den Aspekten, welche das Klima zu einem komplexen System machen.
Zu den Aspekten, welche das Klima zu einem komplexen System machen.
Zur Bedeutung chaotischer Einflüsse auf das Wetter.
Zur Bedeutung chaotischer Einflüsse auf das Wetter.
Spekulationen zur Frage, wie das Klima der Schweiz vor 20 Millionen Jahren ausgesehen habe: Palmen und Strände.
Spekulationen zur Frage, wie das Klima der Schweiz vor 20 Millionen Jahren ausgesehen habe: Palmen und Strände.
Hinweis auf die Ursache eines abrupten Klimawandels vor 55 Millionen Jahren: Die Freisetzung von Methangas aus den Tiefen des Ozeans (hydriertes Methan).
Hinweis auf die Ursache eines abrupten Klimawandels vor 55 Millionen Jahren: Die Freisetzung von Methangas aus den Tiefen des Ozeans (hydriertes Methan).
Zur Bedeutung der Aerosole für das Klima.
Zur Bedeutung der Aerosole für das Klima.
Zur Bedeutung der Eisbildung auf die globale ozeanische Zirkulation des Wassers - eine noch wesentlich unklare Komponente in der Klimamodellierung. Ein weiterer Artikel führt Argumente gegen die Behauptung auf, die…
Zur Bedeutung der Eisbildung auf die globale ozeanische Zirkulation des Wassers - eine noch wesentlich unklare Komponente in der Klimamodellierung. Ein weiterer Artikel führt Argumente gegen die Behauptung auf, die CO2-Konzentration sei der wesentliche Marker für Klimaveränderungen.
Zu den statistischen Methoden zur Validierung der Ergebnisse der Klimasimulation.
Zu den statistischen Methoden zur Validierung der Ergebnisse der Klimasimulation.
Zur Erforschung des anthropogenen CO2 auf das Klima und das Pflanzenwachstum.
Zur Erforschung des anthropogenen CO2 auf das Klima und das Pflanzenwachstum.
Zum Problem den Einfluss der Aerosole auf das Klima (via Wolkenbildung) zu modellieren.
Zum Problem den Einfluss der Aerosole auf das Klima (via Wolkenbildung) zu modellieren.
Zur Frage, wie aus einer Dunstglocke eine Wolkendecke entstehen kann (bzw. der Einfluss der Aerosole).
Zur Frage, wie aus einer Dunstglocke eine Wolkendecke entstehen kann (bzw. der Einfluss der Aerosole).
Aerosole sollen offenbar die Wolkenbildung vermindern.
Aerosole sollen offenbar die Wolkenbildung vermindern.
Zur Simulation der Snowball Earth: Möglicherweise waren die Ozeane eisfrei.
Zur Simulation der Snowball Earth: Möglicherweise waren die Ozeane eisfrei.
Wälder werden bei einer Erwärmung offenbar nicht zu einer verstärkten Quelle von CO2.
Wälder werden bei einer Erwärmung offenbar nicht zu einer verstärkten Quelle von CO2.
Wie man durch die Untersuchung von Seesedimenten auf die Variabilität des Klimas schliessen kann.
Wie man durch die Untersuchung von Seesedimenten auf die Variabilität des Klimas schliessen kann.
Zur Bedeutung des Einflusses der Wälder in der Klimamodellierung. Möglicherweise nimmt die Emission von CO2 aufgrund Abbau von pflanzlichem Material bei einer Klimaerwärmung nicht zu.
Zur Bedeutung des Einflusses der Wälder in der Klimamodellierung. Möglicherweise nimmt die Emission von CO2 aufgrund Abbau von pflanzlichem Material bei einer Klimaerwärmung nicht zu.
Zum Stand des Wissens über die Ursachen der Eiszeiten.
Zum Stand des Wissens über die Ursachen der Eiszeiten.
Warum die Gefahr, der Klimawandel könne zu einem Versiegen des Golfstroms führen, klein sei.
Warum die Gefahr, der Klimawandel könne zu einem Versiegen des Golfstroms führen, klein sei.
Zur Frage, welchen Einfluss Aerosole auf das Klima haben und wie man das untersuchen kann.
Zur Frage, welchen Einfluss Aerosole auf das Klima haben und wie man das untersuchen kann.
Die Klimadaten über die letzte Eiszeit dienen zur Validierung von Klimamodellen: die Modelldaten stimmen mit den Messdaten nur teilweise überein.
Die Klimadaten über die letzte Eiszeit dienen zur Validierung von Klimamodellen: die Modelldaten stimmen mit den Messdaten nur teilweise überein.
Zur Kontroverse um die Kohlenstoffbilanz Nordamerikas bzw. zur Frage, inwieweit Wälder eine CO2-Senke darstellen.
Zur Kontroverse um die Kohlenstoffbilanz Nordamerikas bzw. zur Frage, inwieweit Wälder eine CO2-Senke darstellen.
Zu den indirekten Wirkungen der Variabilität der Sonnenaktivität auf das Klima - diese werden möglicherweise unterschätzt.
Zu den indirekten Wirkungen der Variabilität der Sonnenaktivität auf das Klima - diese werden möglicherweise unterschätzt.
Variabilitäten der Sonnenaktivität (Strahlung) von einer Promille triggert eine Klimavariabilität m Umfang von 0.5 Grad.
Variabilitäten der Sonnenaktivität (Strahlung) von einer Promille triggert eine Klimavariabilität m Umfang von 0.5 Grad.
Zum Stand der Klimamodellierung - insbesondere betreffend des Einbezugs der Ozeane.
Zum Stand der Klimamodellierung - insbesondere betreffend des Einbezugs der Ozeane.
Zum Einfluss der Sonne auf das Klima.
Zum Einfluss der Sonne auf das Klima.
Zu den kulturgeschichtlichen Spuren, welche Klimaveränderungen hinterlassen (kulturelle Blütezeiten, Hungersnöte, Völkerwanderungen etc.).
Zu den kulturgeschichtlichen Spuren, welche Klimaveränderungen hinterlassen (kulturelle Blütezeiten, Hungersnöte, Völkerwanderungen etc.).
Warum es auch eine Klimaerwärmung ohne CO2-Anstieg geben kann.
Warum es auch eine Klimaerwärmung ohne CO2-Anstieg geben kann.
Zum ungewissen Effekt der Aerosole auf das Weltklima.
Zum ungewissen Effekt der Aerosole auf das Weltklima.
Wie der Nordatlantik als Klimaschaukel wirkt und das Wetter in Europa beeinflusst.
Wie der Nordatlantik als Klimaschaukel wirkt und das Wetter in Europa beeinflusst.
Aufgrund der Erforschung der antarktischen Trockentäler nimmt man an, dass ein Aufschmelzen des antarktischen Eisschildes trotz Klimaerwärmung unwahrscheinlich sei.
Aufgrund der Erforschung der antarktischen Trockentäler nimmt man an, dass ein Aufschmelzen des antarktischen Eisschildes trotz Klimaerwärmung unwahrscheinlich sei.
Zur Bedeutung des Schnees für den Permafrost.
Zur Bedeutung des Schnees für den Permafrost.
Argumente zur These, die Variabilität der Sonnenaktivität bestimme wesentlich das Klima.
Argumente zur These, die Variabilität der Sonnenaktivität bestimme wesentlich das Klima.
Einige Hintergründe zum Phänomen El Nino.
Einige Hintergründe zum Phänomen El Nino.
Zur Bedeutung der astronomischen Parameter für die Erzeugung von Eiszeiten.
Zur Bedeutung der astronomischen Parameter für die Erzeugung von Eiszeiten.
Zum Wechselspiel der nördlichen und südlichen Hemisphäre beim Triggern rascher Klimaveränderungen.
Zum Wechselspiel der nördlichen und südlichen Hemisphäre beim Triggern rascher Klimaveränderungen.
Wie sich der westantarktische Eisschild bewegt (immer schneller).
Wie sich der westantarktische Eisschild bewegt (immer schneller).
Übersicht über den Stand der Klimaforschung.
Übersicht über den Stand der Klimaforschung.
Abschätzungen zur Frage, wie schnell das Eis auf Grönland schmilzt.
Abschätzungen zur Frage, wie schnell das Eis auf Grönland schmilzt.