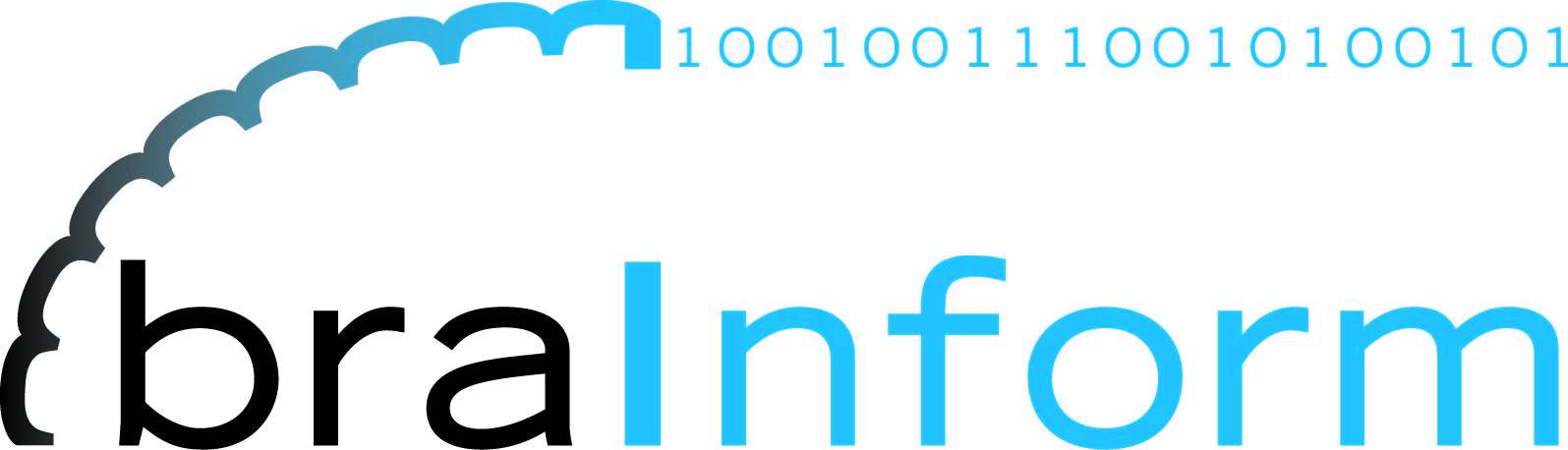Wie die Linke mit Faschismus- und Genozidvorwürfen gegen Journalisten schiesst
Wie die Linke mit Faschismus- und Genozidvorwürfen gegen Journalisten schiesst
Nicht wenige so genannte palästinensische Journalisten sind Propagandisten der Hamas.
Nicht wenige so genannte palästinensische Journalisten sind Propagandisten der Hamas.
Zur Frage: bis wann ist man Journalist und ab wann ist man Propagandist
Zur Frage: bis wann ist man Journalist und ab wann ist man Propagandist
Die Unbelehrbarkeit der deutschen Mainstream-Medien am Beispiel des Sommer-Interviews mit der ADF wird das Gegenteil des Beabsichtigten haben.
Die Unbelehrbarkeit der deutschen Mainstream-Medien am Beispiel des Sommer-Interviews mit der ADF wird das Gegenteil des Beabsichtigten haben.
Zur Blindheit der Medien bei Fakten, die ihnen nicht in den Kram passen (Beispiel Kambodscha)
Zur Blindheit der Medien bei Fakten, die ihnen nicht in den Kram passen (Beispiel Kambodscha)
Viele Elemente der Correctiv-Story haben sich als falsch erwiesen, was aber in den deutschen Medien kaum thematisiert wird.
Viele Elemente der Correctiv-Story haben sich als falsch erwiesen, was aber in den deutschen Medien kaum thematisiert wird.
Die Angst vor Desinformation ist deutlich grösser als die Wirkung vor Desinformation.
Die Angst vor Desinformation ist deutlich grösser als die Wirkung vor Desinformation.
Ideologisierte Faktenchecker erweisen dem Journalismus einen Bärendienst.
Ideologisierte Faktenchecker erweisen dem Journalismus einen Bärendienst.
Die zweifel am Correctiv-Beitrag wachsen, was zeigt: die selbsternannten Faktenprüfer sind ideologische Akteure.
Die zweifel am Correctiv-Beitrag wachsen, was zeigt: die selbsternannten Faktenprüfer sind ideologische Akteure.
Die Recherche-Plattform Organized Crime and Corruption Reporting Project wird von der US-Regierung finanziert und verschliesst die Augen vor US-Korruption.
Die Recherche-Plattform Organized Crime and Corruption Reporting Project wird von der US-Regierung finanziert und verschliesst die Augen vor US-Korruption.
Wie die deutsche Presse auf staatliche Unterstützung hiofft und damit letztlich den Vorwurf der "Systemmedien" stützt.
Wie die deutsche Presse auf staatliche Unterstützung hiofft und damit letztlich den Vorwurf der "Systemmedien" stützt.
Zur Mitschuld der Journalisten bezüglich dem Vertrauensverlust in die Medien.
Zur Mitschuld der Journalisten bezüglich dem Vertrauensverlust in die Medien.
Das Phänomen der Pink Slime: Tausende Medienportale, die wich "echte" Medien aussehen aber Falschnachrichten verbreiten.
Das Phänomen der Pink Slime: Tausende Medienportale, die wich "echte" Medien aussehen aber Falschnachrichten verbreiten.
Der aktivistische Journalismus der deutschen Staatsmedien ist mitverantwortlich für das Erstarken der AfD
Der aktivistische Journalismus der deutschen Staatsmedien ist mitverantwortlich für das Erstarken der AfD
Wie die informationsflut Menschen in einen permanenten Alarmzustand versetzt.
Wie die informationsflut Menschen in einen permanenten Alarmzustand versetzt.
Julian Assange ist weit davon entfernt, irgend einer Medienethik zu folgen.
Julian Assange ist weit davon entfernt, irgend einer Medienethik zu folgen.
Wie das fragwürdige Narrativ eines Masterplans Remigration entstanden ist - Einblicke von Betroffenen.
Wie das fragwürdige Narrativ eines Masterplans Remigration entstanden ist - Einblicke von Betroffenen.
Der Correctiv-Artikel zur Remigration wird zum Gerichtsfall.
Der Correctiv-Artikel zur Remigration wird zum Gerichtsfall.
Wie sich eine durch dünne Fakten gestützte Recherche von Correctiv zu einem Selbstläufer entwickelt hat. Die Tatsache, dass nur wenige Journalisten das hinterfragen zeigt den Grad der Ideologisierung der Medien.
Wie sich eine durch dünne Fakten gestützte Recherche von Correctiv zu einem Selbstläufer entwickelt hat. Die Tatsache, dass nur wenige Journalisten das hinterfragen zeigt den Grad der Ideologisierung der Medien.
Die faktenfreie Weltsicht westlicher Russland-Propagandisten am beispiel des Putin-Interviews durch Tucker Carlson.
Die faktenfreie Weltsicht westlicher Russland-Propagandisten am beispiel des Putin-Interviews durch Tucker Carlson.
Bei den bauernprotesten sind die deutschen Medien gerne im Beschimpfungs-Modus - doch bei den Klimaklebern sind sie nett.
Bei den bauernprotesten sind die deutschen Medien gerne im Beschimpfungs-Modus - doch bei den Klimaklebern sind sie nett.
Beispiel eine Fake-News-Schleuder: Radio Genoa
Beispiel eine Fake-News-Schleuder: Radio Genoa
So genannte Native Ads finden sich in immer mehr medien, doch die leute merken das nur zum Teil.
So genannte Native Ads finden sich in immer mehr medien, doch die leute merken das nur zum Teil.
Ein bekannter deutscher "Russland-Journalist" wurde von Russland bezahlt und war demnach Teil eienr Informationsoperation.
Ein bekannter deutscher "Russland-Journalist" wurde von Russland bezahlt und war demnach Teil eienr Informationsoperation.
Auch Bildagenturen verbreiten immer mehr KI-generierte Bilder, ohne das auszuweisen.
Auch Bildagenturen verbreiten immer mehr KI-generierte Bilder, ohne das auszuweisen.
Wie der Sender al-Jazeera regelmässig Terror gegen Israel rechtfertigt.
Wie der Sender al-Jazeera regelmässig Terror gegen Israel rechtfertigt.
Warum KI das Vertrauen in Informationen untergraben wird.
Warum KI das Vertrauen in Informationen untergraben wird.
Die medien sollte eine Aufarbeitung machen über die Art und Weise, wie sie in der Corona-Zeit die Gesellschaft mit ihrer Rhetorik gespalten haben.
Die medien sollte eine Aufarbeitung machen über die Art und Weise, wie sie in der Corona-Zeit die Gesellschaft mit ihrer Rhetorik gespalten haben.
Das Bundesgericht bestätigt eine einseitige Darstellung von Massnahmenkritikern in den Staatsmedien.
Das Bundesgericht bestätigt eine einseitige Darstellung von Massnahmenkritikern in den Staatsmedien.
In Deutschland verkaufen die Staatsmedien betreutes Denken als objektiven Journalismus.
In Deutschland verkaufen die Staatsmedien betreutes Denken als objektiven Journalismus.
Auch bei der Soros-Stiftung stellen sich wegen Intransparenz Fragen - doch denen wollen die Medien kaum nachgehen.
Auch bei der Soros-Stiftung stellen sich wegen Intransparenz Fragen - doch denen wollen die Medien kaum nachgehen.
Zur Frage, ab wann man ein "Journalist" ist und besonderen Schutz an Demonstrationen geniesst.
Zur Frage, ab wann man ein "Journalist" ist und besonderen Schutz an Demonstrationen geniesst.
Die systematische Überhöhung des Themas Klimawandel durch duie deutschen Staatsmedien (und wie man das mit einer lächerlichen Studie verheimlichen will).
Die systematische Überhöhung des Themas Klimawandel durch duie deutschen Staatsmedien (und wie man das mit einer lächerlichen Studie verheimlichen will).
Porträt einer firma, welche die Newseinträge von Kriminellen löscht.
Porträt einer firma, welche die Newseinträge von Kriminellen löscht.
Wie Medien Kinder instrumentalisieren, wenn es ihnen passt (Klima) und die instrumentalisierung der Kinder angrangern, wenn es ihnen passt (Corona).
Wie Medien Kinder instrumentalisieren, wenn es ihnen passt (Klima) und die instrumentalisierung der Kinder angrangern, wenn es ihnen passt (Corona).
Zwischen Berset und dem Ringier-Verlag gab es eine Standleitung für Indiskretionen.
Zwischen Berset und dem Ringier-Verlag gab es eine Standleitung für Indiskretionen.
Die Republik hat selbst (unwissentlich?) Steuerhinterziehung begangen.
Die Republik hat selbst (unwissentlich?) Steuerhinterziehung begangen.
Fallbeispiel einer Medienzensur (Fasnachtszeitung) in der Schweiz wegen Mussolini.
Fallbeispiel einer Medienzensur (Fasnachtszeitung) in der Schweiz wegen Mussolini.
Poeträt eines amerikanischen Youtube-Journalisten, der mit allen spricht (und sie so entlarvt, statt eigene Botschaften zu verbreiten)
Poeträt eines amerikanischen Youtube-Journalisten, der mit allen spricht (und sie so entlarvt, statt eigene Botschaften zu verbreiten)
Wie rechte und linke Publizisten einen Vorwurf des "russophobie-Rassismus" konstruieren, der falsch ist und von den Verbrechen des Putin-Regimes ablenken soll.
Wie rechte und linke Publizisten einen Vorwurf des "russophobie-Rassismus" konstruieren, der falsch ist und von den Verbrechen des Putin-Regimes ablenken soll.
Stimmungswandel bei den Gesinnungs-Journalisten in Deutschland, gestern noch gegen Nato und Russland-verständig, heute zeigt man auf die Leute mit der gleichen Vehemenz.
Stimmungswandel bei den Gesinnungs-Journalisten in Deutschland, gestern noch gegen Nato und Russland-verständig, heute zeigt man auf die Leute mit der gleichen Vehemenz.
Die Geschichte eines Frontbildes der New York Times, welche die Opfer eines Kriegsverbrechens in der Ukraine zeigt.
Die Geschichte eines Frontbildes der New York Times, welche die Opfer eines Kriegsverbrechens in der Ukraine zeigt.
Zu den Grenzen von Fakten-Checks gegen Desinformation.
Zu den Grenzen von Fakten-Checks gegen Desinformation.
Die die Medien in den USA zunehmend nur noch ihre Bubbles bedienen, was zur Polarisierung beiträgt. Man ist eben genauso abhängig von seinen Lesern, wenn das die einzige ökonomische Basis…
Die die Medien in den USA zunehmend nur noch ihre Bubbles bedienen, was zur Polarisierung beiträgt. Man ist eben genauso abhängig von seinen Lesern, wenn das die einzige ökonomische Basis ist.
Warum Journalisten Berichte über sexuellen Missbrauch nicht ungeprüft verbreiten dürfen.
Warum Journalisten Berichte über sexuellen Missbrauch nicht ungeprüft verbreiten dürfen.
Warum Triage gar kein so einfaches Problem ist.
Warum Triage gar kein so einfaches Problem ist.
Zu den Gefahren staatsnaher Medien.
Zu den Gefahren staatsnaher Medien.
Wenn die woke Geschichte passt ist es egal, ob sie stimmt oder nicht - Beispiele von Fake News über Rassismus in den USA.
Wenn die woke Geschichte passt ist es egal, ob sie stimmt oder nicht - Beispiele von Fake News über Rassismus in den USA.
Der Mediensektor war in Afghanistan eine Erfolgsgeschichte - und kommt nun unter die Räder der Taliban.
Der Mediensektor war in Afghanistan eine Erfolgsgeschichte - und kommt nun unter die Räder der Taliban.
Die AP offenbart ein totalitäres Faktenverständnis.
Die AP offenbart ein totalitäres Faktenverständnis.
Wie Medien gegen die Corona-Panikmache ankämpfen sollten.
Wie Medien gegen die Corona-Panikmache ankämpfen sollten.
Einblick in die Arbeit von Faktenprüfer.
Einblick in die Arbeit von Faktenprüfer.
Ein Verein in Deutschland will Gleichschaltung der Meinungen im Journalismus unter dem Deckmantel der Diversität.
Ein Verein in Deutschland will Gleichschaltung der Meinungen im Journalismus unter dem Deckmantel der Diversität.
Die New York Times wird zu einem Radikalenblatt von Moral-Aktivisten
Die New York Times wird zu einem Radikalenblatt von Moral-Aktivisten
Soziale Medien wollen keine (für ihre Inhalte verantwortliche) Medien sein, aber zensieren wollen sie doch.
Soziale Medien wollen keine (für ihre Inhalte verantwortliche) Medien sein, aber zensieren wollen sie doch.
Zur medialen Panik-Berichterstattung über Corona.
Zur medialen Panik-Berichterstattung über Corona.
Die Trump-Jahre haben die US-Medien offenbar mindestens teilweise zu dem gemacht, was Trump beschrieben hat.
Die Trump-Jahre haben die US-Medien offenbar mindestens teilweise zu dem gemacht, was Trump beschrieben hat.
Journalisten haben kaum Distanz zur Lobbyarbeit von Hilfswerken und dergleichen.
Journalisten haben kaum Distanz zur Lobbyarbeit von Hilfswerken und dergleichen.
Zur Problematik: wer prüft die Faktenprüfer, denn auch diese machen Fehler.
Zur Problematik: wer prüft die Faktenprüfer, denn auch diese machen Fehler.
Wie der Trumpismus die US-Medien moralisch korrumpiert haben: sie haben die Objektivität verloren und sehen sich als Kämpfer in einer Anti-Trump-Mission.
Wie der Trumpismus die US-Medien moralisch korrumpiert haben: sie haben die Objektivität verloren und sehen sich als Kämpfer in einer Anti-Trump-Mission.
Zur Anbiederung der Institutionen (Medien, Unternehmen, Gerichte) an die Empörungskultur.
Zur Anbiederung der Institutionen (Medien, Unternehmen, Gerichte) an die Empörungskultur.
Wie sich die New York Times selbst in Fakten verhedderte beim Versuch, die Geburtsstunde der USA ideologisch motiviert neu zu setzen.
Wie sich die New York Times selbst in Fakten verhedderte beim Versuch, die Geburtsstunde der USA ideologisch motiviert neu zu setzen.
In den US-Zeitungsredaktionen macht sich eine neue McCarthy-Ära bemerkbar, diesmal von links.
In den US-Zeitungsredaktionen macht sich eine neue McCarthy-Ära bemerkbar, diesmal von links.
Die Trump-Polarisierung sorgt nun auch dafür, dass auch die "Gegenseite" unpassende Stimmen zunehmend ausschliesst - das Beispiel New York Times.
Die Trump-Polarisierung sorgt nun auch dafür, dass auch die "Gegenseite" unpassende Stimmen zunehmend ausschliesst - das Beispiel New York Times.
In den US-Medien macht sich ein neuer Purismus breit (wohl eine Folge der Polarisierung). Wer anderen eine Plattform anbietet, fliegt raus.
In den US-Medien macht sich ein neuer Purismus breit (wohl eine Folge der Polarisierung). Wer anderen eine Plattform anbietet, fliegt raus.
Über die inhaltliche Gleichschaltung des Schweizer Staatsfernsehen.
Über die inhaltliche Gleichschaltung des Schweizer Staatsfernsehen.
Daten zeigen, dass die Medien keine Corona-Panikmache betreiben.
Daten zeigen, dass die Medien keine Corona-Panikmache betreiben.
Zur Tendenz der oberlehrerhaften Bevormundung der deutschen Staatsmedien.
Zur Tendenz der oberlehrerhaften Bevormundung der deutschen Staatsmedien.
Die selektive Wertung von Gewalt bei Demonstrationen von US-Medien (Hongkong vs. anderswo).
Die selektive Wertung von Gewalt bei Demonstrationen von US-Medien (Hongkong vs. anderswo).
Warum sich Medien nicht jedem Shitstorm beugen sollten.
Warum sich Medien nicht jedem Shitstorm beugen sollten.
Warum das Geschichtenerzählen dem Journalismus nicht gut tut.
Warum das Geschichtenerzählen dem Journalismus nicht gut tut.
Die die rot-grüne Mehrheit in den Redaktionen zu Moralismus in den deutschen Zeitungen führt.
Die die rot-grüne Mehrheit in den Redaktionen zu Moralismus in den deutschen Zeitungen führt.
Warum der Verzicht auf Karikaturen in Zeitungen im Zeitalter der political correctness Sinn machen kann.
Warum der Verzicht auf Karikaturen in Zeitungen im Zeitalter der political correctness Sinn machen kann.
Beispiel einer Site (Newsguard), welche die Qualität von Medienbeiträgen im Internet bewerten will.
Beispiel einer Site (Newsguard), welche die Qualität von Medienbeiträgen im Internet bewerten will.
Die psychologischen Grundlagen von Fake News: Menschen glauben das, was sie glauben wollen.
Die psychologischen Grundlagen von Fake News: Menschen glauben das, was sie glauben wollen.
Der Presserat erlässt neue Regeln für Social Media.
Der Presserat erlässt neue Regeln für Social Media.
Eine Hintergedanken zur Desinformation in den elektronischen Medien.
Eine Hintergedanken zur Desinformation in den elektronischen Medien.
Warum es falsch ist, aufgrund der höheren Verbreitung von Fake News Zensurmassnahmen einzuleiten.
Warum es falsch ist, aufgrund der höheren Verbreitung von Fake News Zensurmassnahmen einzuleiten.
Die Spiegel-Affäre zeigt die Blase der Selbstgerechtigkeit, in der sich viele Journalisten befinden.
Die Spiegel-Affäre zeigt die Blase der Selbstgerechtigkeit, in der sich viele Journalisten befinden.
Wie man früher Fake News entlarvt hat: mit den klassischen Methoden der genauen Analyse.
Wie man früher Fake News entlarvt hat: mit den klassischen Methoden der genauen Analyse.
Ein Beispiel aus Senegal, wie der Verweis auf Würde die Medien daran hindert, die Wahrheit zu schreiben.
Ein Beispiel aus Senegal, wie der Verweis auf Würde die Medien daran hindert, die Wahrheit zu schreiben.
Donald Trump nutzt ein manipuliertes Video zum Kampf gegen die Presse: hier wird aufgezeigt, wie das Video manipuliert wurde.
Donald Trump nutzt ein manipuliertes Video zum Kampf gegen die Presse: hier wird aufgezeigt, wie das Video manipuliert wurde.
Nun prüfen Fact-Checker die Fact-Checker und finden einen Bias in der Auswahl der zu checkenden Facts.
Nun prüfen Fact-Checker die Fact-Checker und finden einen Bias in der Auswahl der zu checkenden Facts.
Wie man Schüler schulen will, "alternative Fakten" zu erkennen.
Wie man Schüler schulen will, "alternative Fakten" zu erkennen.
In den Anfängen des Journalismus waren Fake News normal, das gehörte zur Unterhaltung des Lesers; man erwartete nicht, dass die Zeitung die Wahrheizt schrieb.
In den Anfängen des Journalismus waren Fake News normal, das gehörte zur Unterhaltung des Lesers; man erwartete nicht, dass die Zeitung die Wahrheizt schrieb.
Warum sich der Journalismus der Metoo-Bewegung nicht anbiedern sollte.
Warum sich der Journalismus der Metoo-Bewegung nicht anbiedern sollte.
Zu den Gefahren der Social Bots.
Zu den Gefahren der Social Bots.
Wie Journalisten-Organisationen gegen Fake-News kämpfen.
Wie Journalisten-Organisationen gegen Fake-News kämpfen.
Überlegungen zum ethischen Publizieren von Kriegsbildern.
Überlegungen zum ethischen Publizieren von Kriegsbildern.
Überlegungen zur Frage, ob es ethisch ist, für einen Dokumentarilm die Zeugen zu bezahlen.
Überlegungen zur Frage, ob es ethisch ist, für einen Dokumentarilm die Zeugen zu bezahlen.
Wikileaks macht de Faktor einen "Überlastungsangriff" auf die Medien mit seiner Flut von meist irrelevanter Information.
Wikileaks macht de Faktor einen "Überlastungsangriff" auf die Medien mit seiner Flut von meist irrelevanter Information.
Sur Selbstüberschätzung der Meinungs-Eliten (Journalisten und Co.).
Sur Selbstüberschätzung der Meinungs-Eliten (Journalisten und Co.).
Jede fünfte Nachricht in den sozialen Medien während des US-Präsidentschaftswahlkampfs wurde von Computerprogrammen geschrieben.
Jede fünfte Nachricht in den sozialen Medien während des US-Präsidentschaftswahlkampfs wurde von Computerprogrammen geschrieben.
Die Glaubwürdigkeit des Journalismus nimmt ab, jene der Propaganda nimmt zu.
Die Glaubwürdigkeit des Journalismus nimmt ab, jene der Propaganda nimmt zu.
Systematische Untersuchung der Auswirkungen der neuen Medien(nutzung) auf das soziale und politische Leben.
Systematische Untersuchung der Auswirkungen der neuen Medien(nutzung) auf das soziale und politische Leben.
Zur Mitschuld der Medien am Phänomen Trump.
Zur Mitschuld der Medien am Phänomen Trump.
Wie Silicon Valley Gurus predigen zwar Transparenz, wollen aber den Klatsch über sie selbst radikal abstellen.
Wie Silicon Valley Gurus predigen zwar Transparenz, wollen aber den Klatsch über sie selbst radikal abstellen.
Das Gegenstück zum Wutbürger: der Wutjournalist, der seine Leser beschimpft.
Das Gegenstück zum Wutbürger: der Wutjournalist, der seine Leser beschimpft.
Wie ein russischer Journalist die Kreml-Propaganda entlarvt.
Wie ein russischer Journalist die Kreml-Propaganda entlarvt.
Beim Thema Flüchtlinge haben die meisten Medien ihre kritische Distanz verloren und haben Partei bezogen.
Beim Thema Flüchtlinge haben die meisten Medien ihre kritische Distanz verloren und haben Partei bezogen.
Eine Studie über die Verbandelung von Journalisten und (staatlichen) Elite kommt beiden Journalisten gar nicht gut an.
Eine Studie über die Verbandelung von Journalisten und (staatlichen) Elite kommt beiden Journalisten gar nicht gut an.
Die Medien gehen mit dem Vorwurf "Lügenpresse" recht dünnhäutig um, de fakto findet sich in Deutschland in der Tat eine Engführung dessen, was als politisch noch azeptabel gilt.
Die Medien gehen mit dem Vorwurf "Lügenpresse" recht dünnhäutig um, de fakto findet sich in Deutschland in der Tat eine Engführung dessen, was als politisch noch azeptabel gilt.
Auch ein ethisches Thema: die völlig unterschiedliche Gewichtung der Katastrophe in Japan: In Japan konzentriert man sich auf die realen Opfer von Erdbeben und Tsunami, in Europa auf die imaginären…
Auch ein ethisches Thema: die völlig unterschiedliche Gewichtung der Katastrophe in Japan: In Japan konzentriert man sich auf die realen Opfer von Erdbeben und Tsunami, in Europa auf die imaginären Opfer der "Atomkatastrophe".
Gemäss einer Studie finden sich in (nur) 60% aller Medienberichte in der Schweiz Fehler.
Gemäss einer Studie finden sich in (nur) 60% aller Medienberichte in der Schweiz Fehler.
Eine Replik zur "Selbstberäucherungs-These": natürlich sollen Journalisten Stolz sein auf das eigene Produkt. Das ist mit eine Basis für gute Arbeit.
Eine Replik zur "Selbstberäucherungs-These": natürlich sollen Journalisten Stolz sein auf das eigene Produkt. Das ist mit eine Basis für gute Arbeit.
Eine mexikanische Zeitung wendet sich an die Verbrechersyndikate und fragt, was sie noch publizieren dürfen (ausserhalb von Mexico City scheinen Journalisten so was wie Freiwild zu sein).
Eine mexikanische Zeitung wendet sich an die Verbrechersyndikate und fragt, was sie noch publizieren dürfen (ausserhalb von Mexico City scheinen Journalisten so was wie Freiwild zu sein).
Wenn Medien über sich selbst berichten, dominiert die Selbstbeweihräucherung (überrascht?).
Wenn Medien über sich selbst berichten, dominiert die Selbstbeweihräucherung (überrascht?).
Porträt von Seymour Hersh, einem legendären US-Journalisten (Berichte über My Lai, Abu Ghraib) und seinem Wahrheitsethos.
Porträt von Seymour Hersh, einem legendären US-Journalisten (Berichte über My Lai, Abu Ghraib) und seinem Wahrheitsethos.
Die Minarett-Initiative offenbart auch ein medienethisches Problem: Gewisse Fragen werden durch die Medien (mehr oder weniger) konsequent tabuisiert.
Die Minarett-Initiative offenbart auch ein medienethisches Problem: Gewisse Fragen werden durch die Medien (mehr oder weniger) konsequent tabuisiert.
Zur Verrohung der Medien Italiens im Angesicht Berlusconis.
Zur Verrohung der Medien Italiens im Angesicht Berlusconis.
Zur Rolle der verdeckten Ermittlung in den Medien. Offenbar würden US-Journalisten dieses Instrument weit häufiger anwenden als deutsche.
Zur Rolle der verdeckten Ermittlung in den Medien. Offenbar würden US-Journalisten dieses Instrument weit häufiger anwenden als deutsche.
Interessant beim Artikel über Elsässers Publikation "Compact" ist duie Bemerkung, dass die linken Parteien in Deutschland offenbar "rechte" Journalisten von ihren Veranstaltungen ausschliessen.
Interessant beim Artikel über Elsässers Publikation "Compact" ist duie Bemerkung, dass die linken Parteien in Deutschland offenbar "rechte" Journalisten von ihren Veranstaltungen ausschliessen.
Offenbar gab es im Fall des entführten (und freigekommenen) Journalisten Rohdes umfassende Absprachen zur Nichtpublikation von Infos, die auch Wikipedia umfassten.
Offenbar gab es im Fall des entführten (und freigekommenen) Journalisten Rohdes umfassende Absprachen zur Nichtpublikation von Infos, die auch Wikipedia umfassten.
Zu den ethischen Gründen, einige Bilder (im Zusammenhang mit Guantanamo und dergleichen) nicht zu zeigen.
Zu den ethischen Gründen, einige Bilder (im Zusammenhang mit Guantanamo und dergleichen) nicht zu zeigen.
Zum Unterschied Europa-USA betr. Entschuldigungskultur bei Fehlern: bei US-Medien ist das weit gebräuchlicher.
Zum Unterschied Europa-USA betr. Entschuldigungskultur bei Fehlern: bei US-Medien ist das weit gebräuchlicher.
Die Kriegsmetaphorik während der Wirtschaftskrise: sollen Wirtscaftsjournalisten gewisse Dinge nicht mehr schreiben, wenn es der eigenen Wirtschaft schadet?
Die Kriegsmetaphorik während der Wirtschaftskrise: sollen Wirtscaftsjournalisten gewisse Dinge nicht mehr schreiben, wenn es der eigenen Wirtschaft schadet?
Die Aufarbeitung des Debakels um die vermeindliche Neonazi-Attacke auf eine Brasilianerin in Zürich zeigt einmal mehr die sinkende Qualität des Journalismus (weltweit).
Die Aufarbeitung des Debakels um die vermeindliche Neonazi-Attacke auf eine Brasilianerin in Zürich zeigt einmal mehr die sinkende Qualität des Journalismus (weltweit).
Imhof beklagt eine uniforme Berichterstattung im Fall Schmid (aber wenn etwas stimmt, berichten alle dasselbe, oder?).
Imhof beklagt eine uniforme Berichterstattung im Fall Schmid (aber wenn etwas stimmt, berichten alle dasselbe, oder?).
Das "Project Censored" listet in den USA jeweils jene 25 Themen auf, welche in den Medien zu wenig Resonanz gefunden hätten.
Das "Project Censored" listet in den USA jeweils jene 25 Themen auf, welche in den Medien zu wenig Resonanz gefunden hätten.
Zur Trennung zwischen Privatsphäre und dem Öffentlichen, eine Idee der Antike. Und ein weiterer Artikel beurteilt, warum der Sinn für den Schutz Privatspäre im Lauf der letzten Jahre geschwunden ist.
Zur Trennung zwischen Privatsphäre und dem Öffentlichen, eine Idee der Antike. Und ein weiterer Artikel beurteilt, warum der Sinn für den Schutz Privatspäre im Lauf der letzten Jahre geschwunden ist.
Zur Frage, wie gerechtfertigt eigentlich die Trennung zwischen redaktionellem Teil und Anzeigenteil einer Zeitung ist: historisch gesehen ist diese Unterscheidung so klar nicht.
Zur Frage, wie gerechtfertigt eigentlich die Trennung zwischen redaktionellem Teil und Anzeigenteil einer Zeitung ist: historisch gesehen ist diese Unterscheidung so klar nicht.
Zur Geschichte des fotografischen Bildes von Berühmtheiten und der Paparazzi.
Zur Geschichte des fotografischen Bildes von Berühmtheiten und der Paparazzi.
Bücher, welche den medial mitverursachten intellektuellen Niedergang in den USA beklagen.
Bücher, welche den medial mitverursachten intellektuellen Niedergang in den USA beklagen.
Beispiel eines professionellen "Bildverschönerers", der von Prominenten benutzt wird (digitale Anpassung von Filmsequenzen).
Beispiel eines professionellen "Bildverschönerers", der von Prominenten benutzt wird (digitale Anpassung von Filmsequenzen).
Zur Ausländerdebatte in Deutschland und wie es die SVP-Schafe bis dorthin geschafft haben.
Zur Ausländerdebatte in Deutschland und wie es die SVP-Schafe bis dorthin geschafft haben.
Wie sich die Medien in der Globalisierungsdebatte instrumentalisieren lassen.
Wie sich die Medien in der Globalisierungsdebatte instrumentalisieren lassen.
In Redaktionen soll kaum TQM eingeführt sein - doch ist das wirklich so schlecht?
In Redaktionen soll kaum TQM eingeführt sein - doch ist das wirklich so schlecht?
Studie zur Zufriedenheit amerikanischer Journalisten: besser ausgebildet, weniger verdienst, offenbar zufrieden.
Studie zur Zufriedenheit amerikanischer Journalisten: besser ausgebildet, weniger verdienst, offenbar zufrieden.
In Kuba werden vermehrt auslädische Journalisten nicht mehr reingelassen. Kubaner, die mit Journalisten reden, riskieren Repressionen.
In Kuba werden vermehrt auslädische Journalisten nicht mehr reingelassen. Kubaner, die mit Journalisten reden, riskieren Repressionen.
Wie Blogger in Ägypten verfolgt werden, weil sie die Zensur unterlaufen.
Wie Blogger in Ägypten verfolgt werden, weil sie die Zensur unterlaufen.
Zu den Problemen der Journalisten in Mexiko, welche in starkem Masse zu Selbstzensur führen.
Zu den Problemen der Journalisten in Mexiko, welche in starkem Masse zu Selbstzensur führen.
Eine Stude zeigt eine erschreckende Inkompetenz der Journalisten gegenüber den Verlautbarungen der (staatlichen) PR: man plappert nur noch nach. Z.T. sind die Wissensdefizite bei den Journalisten so gross, dass die…
Eine Stude zeigt eine erschreckende Inkompetenz der Journalisten gegenüber den Verlautbarungen der (staatlichen) PR: man plappert nur noch nach. Z.T. sind die Wissensdefizite bei den Journalisten so gross, dass die PR-Leute ihnen nicht einmal mehr erklären können, um was es geht.
Wie sich der Journalistenkodex von Deutschland und der Schweiz unterscheidet.
Wie sich der Journalistenkodex von Deutschland und der Schweiz unterscheidet.
Strassburg gewichtet die Meinungsfreiheit höher als die Sachgerechtigkeit und widerspricht damit der höchsten Schweizer Instanz (man kann also auch Unsinn verbreiten).
Strassburg gewichtet die Meinungsfreiheit höher als die Sachgerechtigkeit und widerspricht damit der höchsten Schweizer Instanz (man kann also auch Unsinn verbreiten).
Zu den ethischen Befürchtungen angesichts des Einstiegs von Finanzfirmen im Medienbereich.
Zu den ethischen Befürchtungen angesichts des Einstiegs von Finanzfirmen im Medienbereich.
Eine Analyse des Versagens der US-Medien hinsichtlich Berichterstattung über Folter durch die US-Armee, die lange verschwiegen wurde.
Eine Analyse des Versagens der US-Medien hinsichtlich Berichterstattung über Folter durch die US-Armee, die lange verschwiegen wurde.
Zum Krieg der gefälschten Bilder im Libanonkrieg: israelische Angriffe werden visuell ausgeschmückt.
Zum Krieg der gefälschten Bilder im Libanonkrieg: israelische Angriffe werden visuell ausgeschmückt.
Zu den Tücken der statistischen Analyse, welche vorab für Medien ein Problem darstellen.
Zu den Tücken der statistischen Analyse, welche vorab für Medien ein Problem darstellen.
Studie über die politische Kommunikation in der Schweiz und ihre Fragmentierung. Erst langsam professionalisiert sich das Gewerbe.
Studie über die politische Kommunikation in der Schweiz und ihre Fragmentierung. Erst langsam professionalisiert sich das Gewerbe.
Ein Kommunikationswissenschaftler hält die Lüge für ein unverzichtbares Element der Kommunikation: PR-Leute sollen lernen, gekonnt zu lügen.
Ein Kommunikationswissenschaftler hält die Lüge für ein unverzichtbares Element der Kommunikation: PR-Leute sollen lernen, gekonnt zu lügen.
Zur steigenden Fehleranfälligkeit des US-Journalismus: 61% der Lokalberichte sind nicht akkurat (dürfte bei uns nicht viel anders sein).
Zur steigenden Fehleranfälligkeit des US-Journalismus: 61% der Lokalberichte sind nicht akkurat (dürfte bei uns nicht viel anders sein).
Untersuchung des Grads an kritischer Berichterstattung über den Irakkrieg in verschiedenen Ländern: Je uneiniger die Machthaber sind, desto freier agiert die Presse (im Sinn der Abweichung von der Staatsräson).
Untersuchung des Grads an kritischer Berichterstattung über den Irakkrieg in verschiedenen Ländern: Je uneiniger die Machthaber sind, desto freier agiert die Presse (im Sinn der Abweichung von der Staatsräson).
Zum Problem der Lüge bei Umfragen und weitere Arten, Umfragen zu seinem Gusto zu manipulieren.
Zum Problem der Lüge bei Umfragen und weitere Arten, Umfragen zu seinem Gusto zu manipulieren.
Zum Eigeninteresse der Journalisten unter ökonomischer Perspektive betrachtet: Man sollte diesen Sachverhalt nicht ignorieren, sondern in den Redaktionen zur Sprache bringen.
Zum Eigeninteresse der Journalisten unter ökonomischer Perspektive betrachtet: Man sollte diesen Sachverhalt nicht ignorieren, sondern in den Redaktionen zur Sprache bringen.
Diskussion der Frage, inwiefern Blogs die Kritikmacht der Medien stärken. Ein weiterer Artikel zum Fall der US-Journalistin Miller, welche in Beugehaft gesteckt wurde, weil sie den Namen eines Informanten nicht…
Diskussion der Frage, inwiefern Blogs die Kritikmacht der Medien stärken. Ein weiterer Artikel zum Fall der US-Journalistin Miller, welche in Beugehaft gesteckt wurde, weil sie den Namen eines Informanten nicht nennen will (der Fall scheint komplizierter als nur schwarz-weiss).
Das National Public Radio gerät in den USA unter Druck der Republikaner - was schlimm ist, denn die machen exzellente Sendungen.
Das National Public Radio gerät in den USA unter Druck der Republikaner - was schlimm ist, denn die machen exzellente Sendungen.
Ein ökonomischer Blick auf Fälschungen in den Medien: in einer Grauzone zahlt sich Unwahrheit für die Täter aus - ein Anreiz für Fälschungen.
Ein ökonomischer Blick auf Fälschungen in den Medien: in einer Grauzone zahlt sich Unwahrheit für die Täter aus - ein Anreiz für Fälschungen.
Blick auf die Geschichte der Zensur: die kirchliche und weltliche Zensur im 18. Jahrhundert, die mit der Aufklärung konfrontiert wurde.
Blick auf die Geschichte der Zensur: die kirchliche und weltliche Zensur im 18. Jahrhundert, die mit der Aufklärung konfrontiert wurde.
Zum Stand der Medienzensur in China - auch im Vergleich zu Indien.
Zum Stand der Medienzensur in China - auch im Vergleich zu Indien.
Zur Tendenz in den Medien, sich immer wieder selbst zu zitieren (eine Art selbstreferenzieller Journalismus, der Wahrnehmungsdefizite aufschaukelt).
Zur Tendenz in den Medien, sich immer wieder selbst zu zitieren (eine Art selbstreferenzieller Journalismus, der Wahrnehmungsdefizite aufschaukelt).
Zur abnehmenden Bedeutung der Werbung in den Medien (Streuverluste, immer diversifiziertere Angebote etc.) und dem Einsatz neuer PR-Strategien, die langfristig das Mediengeschehen beeinflussen dürften.
Zur abnehmenden Bedeutung der Werbung in den Medien (Streuverluste, immer diversifiziertere Angebote etc.) und dem Einsatz neuer PR-Strategien, die langfristig das Mediengeschehen beeinflussen dürften.
In einer Rede erklärt Bosch, warum die Leute den Medien nicht mehr glauben.
In einer Rede erklärt Bosch, warum die Leute den Medien nicht mehr glauben.
Studer skizziert einige Richtlinien zur Frage, wie stark gemachte Interviews von den Interviewten noch redigiert werden dürfen.
Studer skizziert einige Richtlinien zur Frage, wie stark gemachte Interviews von den Interviewten noch redigiert werden dürfen.
Zu den Macken der Autorisierung von Interviews: Vorab im Bundeshaus wird immer mehr an den gemachten Aussagen herumredigiert. Hier stellt sich das ethische Problem, ab wann man das Interview dann…
Zu den Macken der Autorisierung von Interviews: Vorab im Bundeshaus wird immer mehr an den gemachten Aussagen herumredigiert. Hier stellt sich das ethische Problem, ab wann man das Interview dann noch druckt.
Der arabische Sender Al-Jazeera beschliesst einen Ethik-Kodex: ganz harte Bilder sollen nicht mehr gezeigt werden.
Der arabische Sender Al-Jazeera beschliesst einen Ethik-Kodex: ganz harte Bilder sollen nicht mehr gezeigt werden.
Übersicht über die so genannten hybriden Werbeformen wie product placement, Koppelgeschäfte zwischen Redaktion und Werbekunden etc. aus Sicht der Werbebranche.
Übersicht über die so genannten hybriden Werbeformen wie product placement, Koppelgeschäfte zwischen Redaktion und Werbekunden etc. aus Sicht der Werbebranche.
Warum schockierende Bilder allein keinen Informationsgehalt haben (sie können aber zu Ikonen werden).
Warum schockierende Bilder allein keinen Informationsgehalt haben (sie können aber zu Ikonen werden).
Fallbeispiel eines Journalisten, der gefälschte Berichte verkauft hat (USA Today).
Fallbeispiel eines Journalisten, der gefälschte Berichte verkauft hat (USA Today).
Analyse der Risikowahrnehmungsverzerrung durch Medienberichterstattung am Beispiel BSE.
Analyse der Risikowahrnehmungsverzerrung durch Medienberichterstattung am Beispiel BSE.
Übersicht über die Gefahrenlage für Journalisten in Osteuropa. Übergriffe gibt es, doch die scheinen nicht so effektiv zu sein.
Übersicht über die Gefahrenlage für Journalisten in Osteuropa. Übergriffe gibt es, doch die scheinen nicht so effektiv zu sein.
Hintergrund zur neuen Medienstrategie der US-Armee: der „eingebetteten Journalisten“.
Hintergrund zur neuen Medienstrategie der US-Armee: der „eingebetteten Journalisten“.
Zur Berichterstattung über den Fall Kelly (Geheimdienstberichte über angebliche Massenvernichtungswaffen im Irak) in den britischen Medien.
Zur Berichterstattung über den Fall Kelly (Geheimdienstberichte über angebliche Massenvernichtungswaffen im Irak) in den britischen Medien.
Zum Verhältnis zwischen Journalismus und PR an einem unappetitlichen Beispiel: Wenn PR-Leute Gerüchte streuen, um missliebige Journalisten unglaubwürdig zu machen.
Zum Verhältnis zwischen Journalismus und PR an einem unappetitlichen Beispiel: Wenn PR-Leute Gerüchte streuen, um missliebige Journalisten unglaubwürdig zu machen.
Zum Stand der Medienverfolgung in Weissrussland: Schliessungen, Einschüchterungen und Zensur sind an der Tagesordnung.
Zum Stand der Medienverfolgung in Weissrussland: Schliessungen, Einschüchterungen und Zensur sind an der Tagesordnung.
Beispiel einer Kriegslüge: Die Geschichte um die US-Soldatin Jessica Lynch erweist sich als aufgebauscht und teilweise erfunden.
Beispiel einer Kriegslüge: Die Geschichte um die US-Soldatin Jessica Lynch erweist sich als aufgebauscht und teilweise erfunden.
Die Bedeutung des investigativen Journalismus nimmt ab - Information wird mehr und mehr rezykliert.
Die Bedeutung des investigativen Journalismus nimmt ab - Information wird mehr und mehr rezykliert.
Ein Buch beschreibt die Propaganda und ihre Wirkung auf die Medien im Jugoslawienkrieg.
Ein Buch beschreibt die Propaganda und ihre Wirkung auf die Medien im Jugoslawienkrieg.
Wie man digitale Bildfälschung erkennen kann - offenbar einfacher als analoge Fälschungen.
Wie man digitale Bildfälschung erkennen kann - offenbar einfacher als analoge Fälschungen.
Fallbeispiel von Persönlichkeitsverletzungen durch die Medien: Die Berichterstattung durch Tele Züri. Beschwert man sich, wird weiter berichtet und man bleibt länger in der Schusslinie.
Fallbeispiel von Persönlichkeitsverletzungen durch die Medien: Die Berichterstattung durch Tele Züri. Beschwert man sich, wird weiter berichtet und man bleibt länger in der Schusslinie.
Zur Bedrohung der Pressefreiheit durch Drogenmafia und Guerilla in Südamerika.
Zur Bedrohung der Pressefreiheit durch Drogenmafia und Guerilla in Südamerika.
Ein Blick auf die so genannte Empörungskommunikation: das Nutzen der moralischen Verurteilung durch die Medien.
Ein Blick auf die so genannte Empörungskommunikation: das Nutzen der moralischen Verurteilung durch die Medien.
Ein exemplarischer Fall über die Machenschaften des Boulevards (Kampagne-Journalismus des Blick): die Geschichte einer angeblichen Tierquälerei in Zürich.
Ein exemplarischer Fall über die Machenschaften des Boulevards (Kampagne-Journalismus des Blick): die Geschichte einer angeblichen Tierquälerei in Zürich.
Hier werden die Richtlinien des Presserates zur Berichterstattung über Ausländer kritisiert: diese bildeten eine Gängelung der Journalisten.
Hier werden die Richtlinien des Presserates zur Berichterstattung über Ausländer kritisiert: diese bildeten eine Gängelung der Journalisten.
Kritische Bemerkungen zur Verwässerung des Quellenschutzes nach 9/11.
Kritische Bemerkungen zur Verwässerung des Quellenschutzes nach 9/11.
Eine Studie die zeigt, dass Medien insbesondere bei Krisensituationen zu Herdenverhalten neigen und die Kritik auf der Strecke bleibt.
Eine Studie die zeigt, dass Medien insbesondere bei Krisensituationen zu Herdenverhalten neigen und die Kritik auf der Strecke bleibt.
Eine Studie behauptet, dass die Öffentlichkeitsarbeit in Unternehmen, und Behörden meist von Laien wahrgenommen werde.
Eine Studie behauptet, dass die Öffentlichkeitsarbeit in Unternehmen, und Behörden meist von Laien wahrgenommen werde.
Fallbeispiel einer Falschaussage, die durch Kontextveränderung entstanden ist: Die Jubel-Bilder aus Ramallah nach den Terroranschlägen des 11. Septembers.
Fallbeispiel einer Falschaussage, die durch Kontextveränderung entstanden ist: Die Jubel-Bilder aus Ramallah nach den Terroranschlägen des 11. Septembers.
Wie gefälschter Journalismus ein Unternehmen zugrunde richten kann: das Beispiel der Agentur Elite, welche durch einen BBC-Bericht in den Abgrund getrieben wurde. Im Nachhinein ergab sich, dass die Inhalte des…
Wie gefälschter Journalismus ein Unternehmen zugrunde richten kann: das Beispiel der Agentur Elite, welche durch einen BBC-Bericht in den Abgrund getrieben wurde. Im Nachhinein ergab sich, dass die Inhalte des Berichts weitgehend erfunden wurden.
Zu den Zensurbemühungen der arabischen Regierungen gegenüber ihrer Bevölkerung - eine Übersicht.
Zu den Zensurbemühungen der arabischen Regierungen gegenüber ihrer Bevölkerung - eine Übersicht.
Übersicht über verschiedene Formen der Regulierung der Presse in unterschiedlichen europäischen Staaten.
Übersicht über verschiedene Formen der Regulierung der Presse in unterschiedlichen europäischen Staaten.
Fallbeispiele über die Berichterstattung des Afghanistan-Kriegs (z.B. über das Arrangieren von Szenen für das Fernsehen).
Fallbeispiele über die Berichterstattung des Afghanistan-Kriegs (z.B. über das Arrangieren von Szenen für das Fernsehen).
Kritische Bemerkungen zu den Bemühungen, Journalismus zu einem Beruf zu machen, der eine staatliche Anerkennung braucht.
Kritische Bemerkungen zu den Bemühungen, Journalismus zu einem Beruf zu machen, der eine staatliche Anerkennung braucht.
Zu den ökonomischen Mechanismen der Bildgewinnung rund um die Terroranschläge des 11. September: wie Touristenkameras plötzlich Gold wert waren.
Zu den ökonomischen Mechanismen der Bildgewinnung rund um die Terroranschläge des 11. September: wie Touristenkameras plötzlich Gold wert waren.
Zur Rolle der Medien bei der humanitären Arbeit: deren Bilder dienen nicht nur der Erzeugung eines günstigen Klimas für die Mittelgenerierung, sondern auch der Aufklärung der Betroffenen selbst.
Zur Rolle der Medien bei der humanitären Arbeit: deren Bilder dienen nicht nur der Erzeugung eines günstigen Klimas für die Mittelgenerierung, sondern auch der Aufklärung der Betroffenen selbst.
Zu den statistischen Fallgruben, die sich auftun, wenn Medien neue gefahrvolle Trends entdecken.
Zu den statistischen Fallgruben, die sich auftun, wenn Medien neue gefahrvolle Trends entdecken.
Beobachtung, dass es keine europäische Öffentlichkeit gibt und damit auch keine einheitlichen Standards, welche Art von Berichterstattung als moralisch Verwerflich gilt.
Beobachtung, dass es keine europäische Öffentlichkeit gibt und damit auch keine einheitlichen Standards, welche Art von Berichterstattung als moralisch Verwerflich gilt.
Bericht über eine Tagung zur Frage, wie man journalistische Qualität messen könne. Dazu finden sich hier einige Beispiele.
Bericht über eine Tagung zur Frage, wie man journalistische Qualität messen könne. Dazu finden sich hier einige Beispiele.
Blum gibt einen Überblick über die wichtigsten Aspekte eines qualitativ guten Journalismus.
Blum gibt einen Überblick über die wichtigsten Aspekte eines qualitativ guten Journalismus.
Stöhlkers Werbetext über die Wichtigkeit einer systemischen PR.
Stöhlkers Werbetext über die Wichtigkeit einer systemischen PR.
Das so genannte Intereffikationsmodell für die Erklärung des Zusammenwirkens von Journalismus und PR.
Das so genannte Intereffikationsmodell für die Erklärung des Zusammenwirkens von Journalismus und PR.
Hier wird aufgezeigt, warum die Öffentlichkeitsarbeit keine umfassende Kontrolle über die Agenda der Medienredaktionen haben kann.
Hier wird aufgezeigt, warum die Öffentlichkeitsarbeit keine umfassende Kontrolle über die Agenda der Medienredaktionen haben kann.
Zur Aufweichung der „chinesischen Mauer“ zwischen Verlag und Redaktion bei den amerikanischen Medien.
Zur Aufweichung der „chinesischen Mauer“ zwischen Verlag und Redaktion bei den amerikanischen Medien.
Eine Analyse über den Einfluss von PR-Fachleuten auf die Agenda der Redaktionen.
Eine Analyse über den Einfluss von PR-Fachleuten auf die Agenda der Redaktionen.
Zu einem erstaunlichen Wandel einer serbischen Zeitung von einem Hetzblatt zu einer tugendhaften Zeitung, indem lediglich die Führung ausgewechselt wurde (und sich natürlich auch das generelle gesellschaftliche Umfeld gewandet hat).
Zu einem erstaunlichen Wandel einer serbischen Zeitung von einem Hetzblatt zu einer tugendhaften Zeitung, indem lediglich die Führung ausgewechselt wurde (und sich natürlich auch das generelle gesellschaftliche Umfeld gewandet hat).
Rechtliche Anmerkungen zur Debatte um Qualität im Journalismus: die derzeitige Gesetzeslage werde den journalistischen Arbeitsbedingungen nicht gerecht.
Rechtliche Anmerkungen zur Debatte um Qualität im Journalismus: die derzeitige Gesetzeslage werde den journalistischen Arbeitsbedingungen nicht gerecht.
Zum Wandel der Wahlkampfwerbung in den USA: politische Inhalte spielen eine immer kleinere Rolle, während Auftreten und Image der Kandidaten wichtig werden.
Zum Wandel der Wahlkampfwerbung in den USA: politische Inhalte spielen eine immer kleinere Rolle, während Auftreten und Image der Kandidaten wichtig werden.
Zum Corporate Publishing - wo sich natürlich die Frage nach der Unabhängigkeit der Berichterstattung in besonderem Masse stellt.
Zum Corporate Publishing - wo sich natürlich die Frage nach der Unabhängigkeit der Berichterstattung in besonderem Masse stellt.
Blum wirbt hier für mehr Geld für seinen Presserat und zeigt, wie das Gremium im Wettbewerb um Aufmerksamkeit bestehen will (u.a. Fälle selbst aufgreifen).
Blum wirbt hier für mehr Geld für seinen Presserat und zeigt, wie das Gremium im Wettbewerb um Aufmerksamkeit bestehen will (u.a. Fälle selbst aufgreifen).
Zu den Versuchen, gewisse Begriffe aus Gründen der politial correctness in den Medien zu verbieten - und was daran problematisch ist.
Zu den Versuchen, gewisse Begriffe aus Gründen der politial correctness in den Medien zu verbieten - und was daran problematisch ist.
Gednaken zum Problem der „Medienopfer“ aus Sicht eines Publizisten: welche Personen gelten als „Personen der Zeitgeschichte“?.
Gednaken zum Problem der „Medienopfer“ aus Sicht eines Publizisten: welche Personen gelten als „Personen der Zeitgeschichte“?.
Zu einem Fall von Fälschung in den Medien: die gefälschten Interviews von Hollywood-Stars (das ist ja einfach zu fälschen).
Zu einem Fall von Fälschung in den Medien: die gefälschten Interviews von Hollywood-Stars (das ist ja einfach zu fälschen).
Zum Kampf um Pressefreiheit in Iran: mehrere Reformzeitungen sind verboten worden.
Zum Kampf um Pressefreiheit in Iran: mehrere Reformzeitungen sind verboten worden.
Überblick über 25 Jahre Kriegsberichterstattung in der US-Armee: Während des Vietnamkriegs waren die Medien noch frei, danach wurden sie mehr und mehr gegängelt (eingebunden).
Überblick über 25 Jahre Kriegsberichterstattung in der US-Armee: Während des Vietnamkriegs waren die Medien noch frei, danach wurden sie mehr und mehr gegängelt (eingebunden).
Theoretische Überlegungen zur Art der Medienkontrolle: Gründe gegen eine zentrale Kontrolle.
Theoretische Überlegungen zur Art der Medienkontrolle: Gründe gegen eine zentrale Kontrolle.
Zum Problem der Glaubwürdigkeit von Hauszeitungen von Unternehmen.
Zum Problem der Glaubwürdigkeit von Hauszeitungen von Unternehmen.
Wie man mit Computertechnik nachträglich Werbebotschaften in Filme reinbringen kann.
Wie man mit Computertechnik nachträglich Werbebotschaften in Filme reinbringen kann.
Eine Bilanz der Lüge und Propaganda beim Kosovo-Krieg von Seiten der Journalisten.
Eine Bilanz der Lüge und Propaganda beim Kosovo-Krieg von Seiten der Journalisten.
Zur zunehmenden Manipulation der Berichterstattung über die Regierungsarbeit durch die Regierung Blair: offenbar werden Mitarbeiter auf allen Stufen angewiesen, wie Medienfragen zu beantworten seien.
Zur zunehmenden Manipulation der Berichterstattung über die Regierungsarbeit durch die Regierung Blair: offenbar werden Mitarbeiter auf allen Stufen angewiesen, wie Medienfragen zu beantworten seien.
Ein Publizistikprofessor sieht in Transparenz und Interaktivität zwei zentrale Merkmale eines erfolgreichen und qualitativ guten Regionaljournalismus - basierend auf einer Forschungsreise in den USA.
Ein Publizistikprofessor sieht in Transparenz und Interaktivität zwei zentrale Merkmale eines erfolgreichen und qualitativ guten Regionaljournalismus - basierend auf einer Forschungsreise in den USA.
Wie französische Experten PR für afrikanische Machthaber machen und damit das Bild Afrikas mitbestimmen.
Wie französische Experten PR für afrikanische Machthaber machen und damit das Bild Afrikas mitbestimmen.
Das Problem der nicht deklarierten Werbung kann genauso gut Sendungen mit linksökologischem Charakter betreffen.
Das Problem der nicht deklarierten Werbung kann genauso gut Sendungen mit linksökologischem Charakter betreffen.
Eine Sammlung von Qualitätsansprüchen an die PR.
Eine Sammlung von Qualitätsansprüchen an die PR.
Zur Medienstrategie um die Ausstellung über die Verbrechen der deutschen Wehrmacht - vorab hinsichtlich des Einsatzes des Bildes. Die Ausstellung selbst kann als Propaganda verstanden werden.
Zur Medienstrategie um die Ausstellung über die Verbrechen der deutschen Wehrmacht - vorab hinsichtlich des Einsatzes des Bildes. Die Ausstellung selbst kann als Propaganda verstanden werden.
Zum Stand der Rechtlage in der Schweiz im Hinblick auf das Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb, das auch gegen Medienvertreter angewendet werden kann (und wird).
Zum Stand der Rechtlage in der Schweiz im Hinblick auf das Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb, das auch gegen Medienvertreter angewendet werden kann (und wird).
Eine Untersuchung, wie Medien mit Umfragen umgehen: hier gibt es ein Qualitätsproblem.
Eine Untersuchung, wie Medien mit Umfragen umgehen: hier gibt es ein Qualitätsproblem.
Umfassender Bericht über die zwiespältige Rolle der Medien im Kosovo-Krieg, welche sich als Propagandamittel instrumentalisieren liessen.
Umfassender Bericht über die zwiespältige Rolle der Medien im Kosovo-Krieg, welche sich als Propagandamittel instrumentalisieren liessen.
Eine US-Studie über die Glaubwürdigkeit der Zeitungen: Die Leser würden diese meist realistischer Einschätzen und haben offenere Augen für Fehlleistrungen der Redaktion als die Journalisten.
Eine US-Studie über die Glaubwürdigkeit der Zeitungen: Die Leser würden diese meist realistischer Einschätzen und haben offenere Augen für Fehlleistrungen der Redaktion als die Journalisten.
Porträt der Zeitschrift Index on Censorship, die einst von Sowjetischen Emigranten gegründet wurde und heute aktuelle Themen wie Zensur im Internet aufgreift.
Porträt der Zeitschrift Index on Censorship, die einst von Sowjetischen Emigranten gegründet wurde und heute aktuelle Themen wie Zensur im Internet aufgreift.
Die Los Angeles Times als Fallbeispiel, wo die „chinesische Mauer“ zwischen Redaktion und Anzeigenabteilung eingerissen wurde: die anfänglich geäusserte Kritik wurde inzwischen zurückgenommen.
Die Los Angeles Times als Fallbeispiel, wo die „chinesische Mauer“ zwischen Redaktion und Anzeigenabteilung eingerissen wurde: die anfänglich geäusserte Kritik wurde inzwischen zurückgenommen.
Gedanken zur Frage, wie sich Qualität im Journalismus definieren lässt. Ein zweiter Artikel thematisiert die Gründung des Vereins „Qualität im Journalismus“. Vergleiche dazu auch die NZZ vom 29.01.99.
Gedanken zur Frage, wie sich Qualität im Journalismus definieren lässt. Ein zweiter Artikel thematisiert die Gründung des Vereins „Qualität im Journalismus“. Vergleiche dazu auch die NZZ vom 29.01.99.
Zum zunehmenden Einfluss von Sponsoren auf das Schweizer Radio und Fernsehen.
Zum zunehmenden Einfluss von Sponsoren auf das Schweizer Radio und Fernsehen.
Hintergrund zu den verschiedenen Techniken zur Bildmanipulation inklusive die bekanntesten Beispiele der jüngeren Zeit: z.B. Luxor. Vgl. dazu auch die NZZ vom 26.01.99 (Aufhänger ist eine entsprechende Ausstellung in Bonn).
Hintergrund zu den verschiedenen Techniken zur Bildmanipulation inklusive die bekanntesten Beispiele der jüngeren Zeit: z.B. Luxor. Vgl. dazu auch die NZZ vom 26.01.99 (Aufhänger ist eine entsprechende Ausstellung in Bonn).
Ein Hintergrund zum Aufkommen der Fotoreportage und den neuen Möglichkeiten der Manipulation, die sich daraus ergeben haben.
Ein Hintergrund zum Aufkommen der Fotoreportage und den neuen Möglichkeiten der Manipulation, die sich daraus ergeben haben.
Zu den Bemühungen der Verleger, ein Gütesiegel für Qualitätsjournalismus einzuführen (mit einem Ombudsmann oder anderen Mitteln).
Zu den Bemühungen der Verleger, ein Gütesiegel für Qualitätsjournalismus einzuführen (mit einem Ombudsmann oder anderen Mitteln).
Zur zunehmenden Ideologisierung der New Yoerk Times: Zensur des Unerwünschten.
Zur zunehmenden Ideologisierung der New Yoerk Times: Zensur des Unerwünschten.